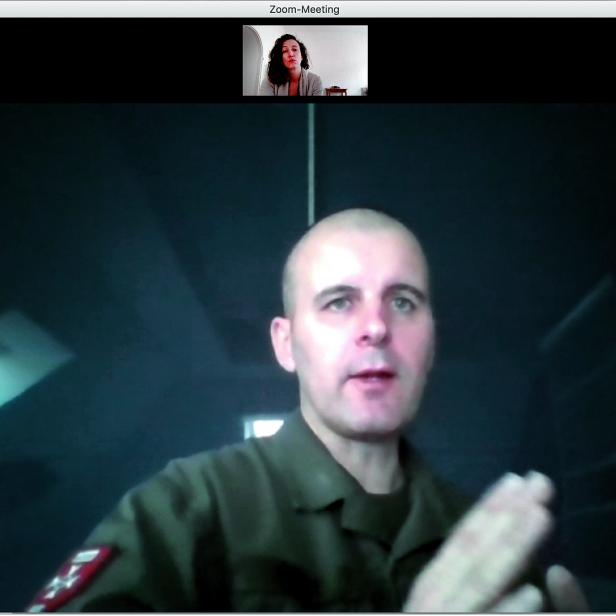Militärexperte Reisner: „Ohne Luftabwehr kann die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen“
profil: Russland hat seine Strategie in der Ukraine geändert und eine Offensive zur Einnahme des Ostens gestartet. Was braucht die Ukraine vom Westen an Waffen, um den Angriff auf den Donbass zurückzuschlagen?
Markus Reisner: Die Waffen, die der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj für sein Land fordert, müssten jetzt schon da sein, um rechtzeitig zum Kampf gegen die russische Offensive zum Einsatz kommen zu können. Das sind sie aber nicht. Die Ukrainer stehen im Donbass fast genauso da wie am 24. Februar - nur sind sie abgenutzter. Sie haben zwar Waffensysteme bekommen, darunter amerikanische Switchblade-Drohnen, sogenannte Kamikaze-Drohnen, von denen alle hoffen, dass sie wieder für Überraschungen sorgen, aber sie brauchen vor allem schwere Waffen – und damit genau jene Waffensysteme, die in den vergangenen Wochen zerstört worden sind: alles, mit dem Gegenangriffe durchgeführt werden können. Dazu zählen Panzer und Artilleriegeschütze, aber auch Luftabwehrsysteme.

Ein ausgebrannter Lieferwagen steht auf einer Landstraße.
Ein ausgebranntes Auto auf der Straße nach Popasna in der Donbass-Region.
profil: Warum sind die Luftabwehrsysteme so wichtig?
Reisner: Die russischen Streitkräfte haben seit dem 24. Februar rund 1.600 Marschflugkörper und ballistische Raketen gegen Ziele in der Ukraine eingesetzt und Depots, Kasernen, Treibstoff- und Munitionslager etc. zerstört. Sie sind in der Lage, alle Ziele in der Ukraine zu beschießen, die sie treffen wollen. Wenn die Russen wollen, schicken sie morgen zehn Iskander-Raketen auf das Regierungsviertel in Kiew. Einfach so, weil sie es können. Diese Angriffe sind nur möglich, weil die Ukrainer kaum noch eine funktionierende Luftabwehr haben. Und ohne Luftabwehr, das ist die bittere Wahrheit, lässt sich dieser Krieg für die Ukraine langfristig nicht gewinnen.
profil: Können Waffen wie die amerikanischen Switchblade-Drohnen etwas ändern?
Reisner: Es kann sein, dass die Switch-Drohnen den Unterschied machen. Sie können in relativ kleinen Kisten verpackt auf einen zivilen Lkw geladen werden. Wenn sie zu Tausenden und kombiniert mit anderen Waffen zum Einsatz kommen, können sie zu einem Abwehrerfolg beitragen – von Rückeroberung ist da nicht die Rede, denn dazu braucht man schwere Waffen. Schweres Gerät wie Panzer muss per Eisenbahn transportiert werden. Und die Russen versuchen seit zwei Wochen gezielt, die Eisenbahnlinien und andere Versorgungslinien abzuschneiden, damit die Ukrainer nichts mehr in den Osten ihres Landes transportieren können. Aus den Erfahrungen der vergangenen Wochen kann man für den Donbass sagen: Es steht 50:50, dass es der Ukraine gelingt, den Vormarsch der Russen dort zu stoppen.
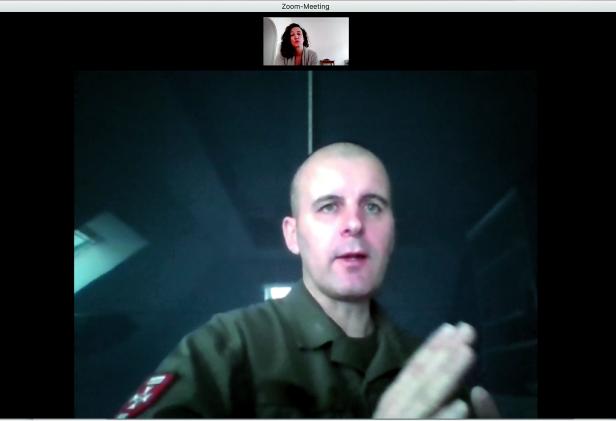
Ein Mann in Uniform und eine Frau nehmen an einem Zoom-Meeting teil.
Markus Reisner im Zoom-Interview mit Siobhán Geets: „Es steht 50:50, dass es der Ukraine gelingt, den Vormarsch der Russen im Donbass zu stoppen.“
profil: Besonders Deutschland wird zögerliches Handeln vorgeworfen. Was kann Europa bei den Waffenlieferungen leisten?
Reisner: Die Deutschen zieren sich, Waffen zu liefern. Es heißt auch, die Marder-Schützenpanzer kämen ohnehin zu spät, denn es müssten ja noch Leute ausgebildet werden. Und sogar die Briten, die vorpreschen, tun sich schwer. Bis man eine britische Panzerhaubitze mit dem Schiff nach Polen und dann über Land bis in die Ukraine gebracht hat und schließlich in den Donbass, sind Wochen, wenn nicht Monate vergangen. Viele Länder waren bereit, viel von diesen Waffen herzugeben. Die ersten Stimmen mahnen aber schon: Wir sollten nicht zu viel an die Ukraine liefern, weil wir dann selbst nichts mehr haben – und wer weiß, was noch kommt.
profil: Und die schweren Waffen? Kiew hat laut den USA bereits Kampfjets aus dem Westen erhalten.
Reisner: Die USA haben nun verkündet, dass es gelungen sei, erstmals Kampfflugzeuge in die Ukraine zu liefern. Dabei dürfte es sich um MiG29 aus westeuropäischen Beständen handeln. Nun hängt es davon ab, wie schnell die Ukrainer sie einsetzen können und vor allem ob die russische Seite sie zerstören kann. Auch über die Ankunft eines Zuges mit Panzern aus Tschechien wissen wir nichts – und irgendwer sollte eigentlich bereits ein Video davon gemacht haben. Artilleriesysteme wurden bisher auch nicht in großen Stückzahlen geliefert. Ein Fliegerabwehrsystem, also etwa das S-300-System, das die Slowaken geliefert haben sollen, haben wir auch nicht im Einsatz gesehen – auch, wenn die Russen behaupten, dass sie einen Teil davon zerstört hätten. Dazu muss man wissen: Vor Kriegsbeginn hatten die Ukrainer knapp 250 Stück dieser S-300 Systeme. Das eine slowakische macht also keinen großen Unterschied. Das Ausmaß der Unterstützung ist vor allem eine moralische Frage: Wollen wir als westliche demokratische Wertegemeinschaft akzeptieren, dass sich ein autoritäres Regime einfach ein Stück des Kuchens nimmt, oder nicht? Wenden wir uns ab oder ziehen wir eine Grenze und verteidigen diese?
profil: Die Russen haben von Beginn an versucht, die Ukrainer im Osten einzukesseln. Das ist bisher nicht gelungen. Stehen die Chancen jetzt, mit dem Fokus auf den Donbass, höher?
Reisner: Die russischen Streitkräfte stehen in einer guten Position. Der Kampf um Mariupol ist vorbei, da geht es nur noch um das Stahlwerk und das bindet kaum russische Kräfte. Vor zwei Wochen haben die Russen begonnen, ihr schweres Gerät von Mariupol abzuziehen und in den Norden zu verlegen, um sich auf die Süd-Zangenbewegung vorzubereiten. Am Anfang haben die russischen Truppen durch kurze Zangenbewegungen versucht, die Ukrainer einzukesseln. Das hat im Süden funktioniert, wo sie sich in Mariupol verbissen haben, aber nicht im Osten. An der Nordfront bei Kiew und östlich davon in Sumy und Charkiw gab es zwei massive Rückschläge: Die Luftlandung in Kiew hat nicht funktioniert und Charkiw hat sich entgegen den Erwartungen nicht ergeben. Die Russen haben erkannt, dass das nicht funktioniert und alle Kräfte in den Donbass im Südosten verlegt. Jetzt wird alles auf eine Karte gesetzt. Es erfolgte erstmals eine klare Schwergewichtsbildung. Die Russen brauchen einen Erfolg im Donbass. Sonst tun sie sich bald schwer zu argumentieren, dass sie starke und fähige Streitmächte haben. Diese Bild haben sie ja in den letzten zwanzig Jahren entstehen lassen. Es steht auf der Kippe.

Luftaufnahme einer zerstörten Industrieanlage in Küstennähe.
Eine Satelliten-Aufnahme zeigt die Azowstal-Stahlwerke im Osten von Mariupol, der letzte Teil der Stadt, der noch nicht unter russischer Kontrolle ist.
profil: Wie viele ukrainische Soldaten sind in dem Gebiet, das die Russen einkesseln wollen?
Reisner: Es dürften sich 30.000 bis 35.000 Soldaten im Donbass verschanzt haben. Das größte Problem ist aber, dass in diesen Gebieten, die wir hier so technisch beschreiben, Hunderttausende Zivilisten leben, die alle eingekesselt wären. Das ist eine humanitäre Katastrophe. Die Bevölkerung wurde bisher schon durch den schnellen Vormarsch der Russen in ihren Städten eingekesselt, etwa in Mariupol, zum Teil auch in Charkiw. Dieses Szenario droht nun erneut, nur in einem noch größeren Maßstab. Aber: Wenn die Russen die Soldaten im Donbass einkesseln, muss die Zangenverbindung nach außen wie nach innen gesichert werden. Das ist, militärisch gesehen, das klassische Problem von Kesseln: dass es einen möglichen Ausbruch gibt oder einen Angriff von außen auf die Umzingelung.
profil: Zuletzt machte ein Video von einer Gruppe ukrainischer Soldaten die Runde, die in russische Gefangenschaft geraten waren. Was passiert mit diesen Kriegsgefangenen?
Reisner: Diese Männer hatten das Glück, dass sie in einer großen Gruppe sind. Wenn in kleinen Gruppen gekämpft, wird, werden die unterlegenen Gegner meistens erschossen. Das passiert auch bei den Tschetschenen in Mariupol, dazu gibt es Fotos, wo drei, vier Ukrainer am Boden liegen. Die wurden einfach niedergemacht. Nördlich von Izjum, in bewaldeten Gebieten, versuchen gerade ukrainische Spezialeinsatzkräfte die Versorgungslinien der Russen anzugreifen, ähnlich wie das zu Beginn der Invasion im Raum Kiew der Fall war. Mittlerweile haben sich die Russen aber darauf eingestellt und setzen diesen ukrainischen Kräften eigene Sondereinheiten entgegen, die Jagd auf die Ukrainer machen. Wir haben in diesen Waldgebieten oft kleine Gruppen von fünf, sechs Spezialkräften, die einander gegenseitig jagen und dann niedermetzeln. Alles Kopfschüsse. In größeren Gruppen ist es sicherer.
profil: Wohin kommen die Überlebenden?
Reisner: Ich denke, dass sie in Lager im Donbass kommen und mehr oder weniger versorgt werden. Das hoffe ich zumindest. Sie sind auch Faustpfand zum Gefangenenaustausch.
profil: Auch russische Soldaten, die in der Ukraine in Kriegsgefangenschaft geraten, müssten in Lager kommen, zu denen dann das Rote Kreuz Zugang hätte. Warum gibt es davon keine Bilder?
Reisner: Ich habe noch kein einziges Video gesehen von russischen Kriegsgefangenen in größerer Zahl auf ukrainischer Seite. Es muss sie geben, aber die Ukrainer halten sich mit Bildern zurück. Die Russen zeigen das, weil sie jetzt zum ersten Mal eine große Anzahl – hunderte Soldaten – präsentieren können.
profil: In Butscha haben ukrainische Soldaten auf einen Schlag etliche russische Panzer zerstört. Es folgte ein Massaker an Zivilisten in dem Vorort von Kiew. Ist bei einer Niederlange der Russen im Donbass mit weiteren solcher Verbrechen zu rechnen?
Reisner: Sie sprechen das Unaussprechliche aus. Wenn die Russen noch einmal verheerende Verluste erleiden, befürchte ich Schlimmes ... Die Ukrainer sind verzweifelt, die Russen sind verbittert. Und Verbitterung und Verzweiflung sind eine toxische Mischung, das hat uns die Geschichte gelehrt. Die Russen können auf ihrem Rückzug verbrannte Erde hinterlassen, wie das die deutsche Wehrmacht in Russland getan hat. Sie können eine Ortschaft nach der anderen dem Erdboden gleichmachen. Das Leid ist ihnen mittlerweile komplett egal. Sie haben kein Mitleid. Aus ihrer Sicht hatten die Ukrainer eine Chance sich zu fügen. Diese Zeit ist nun vorbei.
Oberst Markus Reisner, Jahrgang 1978, leitet die Forschungs- und Entwicklungsabteilung an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt. Reisner studierte Rechtswissenschaften und Geschichte in Wien, zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören unbemannte Waffensysteme sowie historische und aktuelle militärische Entwicklungen. Zuletzt erschien im KRAL-Verlag mit „Die Schlacht um Wien 1945“ sein Buch über die Operation der sowjetischen Streitkräfte in März und April 1945.