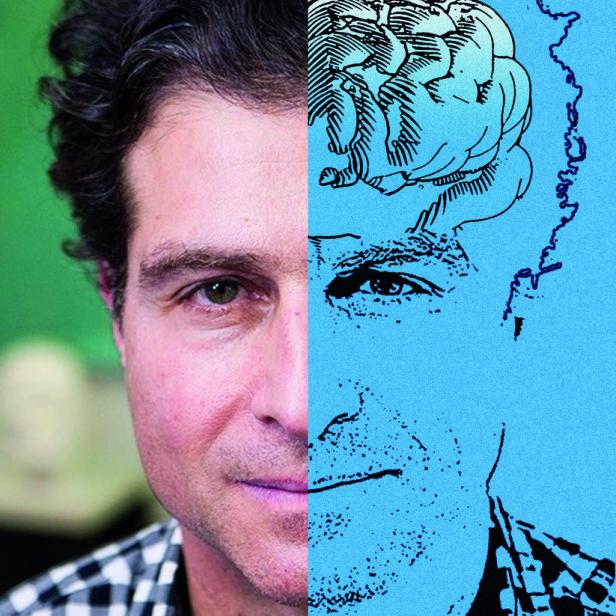Best-of der Archäologie: Goldschätze, Mumien, kopflose Skelette
Die Goldschätze von Troia aus dem Archäologischen Nationalmuseum in Athen in ein Labor zu verfrachten, ist unmöglich. Deshalb blieb es lange ein Rätsel, wo die Menschen vor 4500 Jahren den Rohstoff für die feingliedrigen Schmuckstücke gefunden hatten. Bis sich Barbara Horejs dachte: Wenn das Geschmeide nicht ins Labor kommt, muss das Labor eben zum Geschmeide kommen. Im Prinzip würde es reichen, nur etwas Goldstaub zu entnehmen und diesen anschließend zu analysieren, sagten sich die Leiterin des Österreichischen Archäologischen Institut der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und ihr Kollege Ernst Pernicka von der Universität Tübingen. Mit einem mobilen Laser würden sie ein wenige Mikrometer kleines Loch in die Schmuckstücke schmelzen, das mit dem freien Auge nicht zu sehen wäre.
An Teststücken hatte die Methode bereits geklappt, als das Team im Nationalmuseum in Athen ankam. Dass der Museumsdirektor sie nicht sofort wieder nach Hause schickte, verdankt Barbara Horejs der gemeinsamen Forschungsvergangenheit: „Wir kennen uns schon lange und haben mehrmals zusammen gegraben.“
Goldstaub lüftet Geheimnis
Die Lasermethode funktionierte – nicht einmal die penibelsten Restauratorinnen konnten den sanften Eingriff erkennen. Seither können sich Horejs und Pernicka vor Anfragen kaum retten. Denn die Goldstaubanalyse hat international Furore gemacht: Demnach besteht der legendäre „Schatz des Priamos“ aus Troia aus demselben
Material wie der Schmuck aus den Königsgräbern von Ur in Mesopotamien und weitere Schätze aus Georgien. „Das Gold wurde über ein riesiges Gebiet hinweg gehandelt, von der Ägäis bis in den heutigen Iran“, sagt Horejs. Alles stamme aus den Lagerstätten einer Region, die sie zwar noch nicht identifizieren konnte, aber: „Der Kaukasus ist ein heißer Tipp.“
Die vergangenen Jahre waren reich an Sensationsmeldungen wie jener vom Gold aus Troia. Der berühmte Paläoanthropologe Lee Berger sorgte zuletzt mit seiner Netflix-Dokumentation „Cave of Bones“ für Wirbel, weil er gewagte Behauptungen zu der ausgestorbenen Menschenart Homo naledi anstellte. Manch spektakulärer Fund brachte Licht in lange gehütete Geheimnisse: So verrieten beschriftete Gefäße aus einer Mumienwerkstatt in Ägypten endlich die Zutaten der Einbalsamierer von Tutanchamun und Hatschepsut. Andere wiederum gaben neue Rätsel auf: Wer hat etwa den Toten in einem in der Slowakei entdeckten Massengrab den Kopf abgeschnitten? Und warum? profil hat die spannendsten Erkenntnisse der Archäologie zusammengetragen.
Die Kopflosen von Vráble
37 Skelette von Erwachsenen ohne Kopf, ein Kleinkind mit Schädel: Das Massengrab, das ein Team um die Kieler Archäologin Maria Wunderlich im Sommer 2022 nahe der slowakischen Kleinstadt Vráble aushob, hatte es in sich. Was Wunderlich als Erstes feststellte: Die etwa 7000 Jahre alten Toten waren nicht behutsam gebettet, sondern wahrscheinlich in den Graben vor der Siedlung gerollt oder geworfen worden. Der Graben umfasst eines von drei Dörfern der Jungsteinzeit, die eng beieinanderliegen und Archäologinnen schon länger beschäftigen.
„Es mag naheliegen, ein Massaker mit Menschenopfern zu vermuten, vielleicht sogar in Verbindung mit magischen oder religiösen Vorstellungen. Auch kriegerische Auseinandersetzungen können eine Rolle spielen, zum Beispiel Konflikte zwischen den Dorfgemeinschaften. Sind diese Personen Kopfjägern zum Opfer gefallen oder übten ihre Mitmenschen einen besonderen Totenkult aus, der nichts mit zwischenmenschlicher Gewalt zu tun hatte? Es gibt viele Möglichkeiten. Unstrittig ist aber, dass dieser Fund für das europäische Neolithikum bisher absolut einzigartig ist“, sagt Maria Wunderlich von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
Antworten sollen nun Analysen der antiken DNA, Radiokarbondatierungen und Isotopenanalysen liefern. Sie können klären, ob die Toten Einheimische waren, ob sie ähnlichen Alters waren, ob sie gleichzeitig begraben wurden oder ob der Graben über mehrere Generationen hinweg als Friedhof gedient hat. Die Schädel auch noch zu finden, wäre großartig, auch wenn er da wenig Hoffnung hege, sagt Wunderlichs Kollege Martin Furholt. „Dennoch hat Vráble uns so oft überrascht, wer weiß, was die Fundstelle noch für uns parat hält.“
"Man darf nicht seine Wünsche ausgraben."
Barbara Horejs, Leiterin des Österreichischen Archäologischen Instituts der ÖAW
Die älteste Pizza der Welt?
Die vom Vesuv 79 nach Christus verschüttete Stadt Pompeji ist noch lange nicht fertig ausgegraben – und sorgt deshalb immer wieder für Sensationen. Zuletzt entdeckten Forscherinnen in einem freigelegten Wohnhaus ein Fresko, auf dem eine Art Pizza zu sehen ist. Belegt ist das antike Fladenbrot mit Datteln und Granatapfelkernen, gelbe Punkte könnten eine Art Pesto zeigen. Als „erste Pizza der Menschheit“ ging das 2000 Jahre alte Stillleben um die Welt – auch wenn Expertinnen des Archäologischen Parks in Pompeji schnell abwinkten. Auf dem Fresko fehlen die wichtigsten Zutaten der italienischen Nationalspeise: Tomaten und Mozzarella. Kein Wunder, Erstere kamen erst viel später aus Amerika, der berühmte Käse wurde in der heutigen Form wahrscheinlich erst im 16. Jahrhundert erfunden.
Tatsächlich ist die moderne Pizza viel jünger; einer Legende nach entstand sie 1889. Demnach soll das italienische Königspaar Umberto I. und seine Frau Margherita damals den Pizzabäcker Raffaele Esposito zu sich eingeladen haben. Dieser erfand dafür die
Pizza in den Nationalfarben Grün, Weiß und Rot mit Basilikum, Mozzarella und Tomatensauce und nannte sie, nach der Königin, Pizza Margherita. Gesichert ist diese Anekdote zwar nicht, trotzdem wurde die „Kunst des neapolitanischen Pizzabäckers“ 2017 in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.
Die Knochenhöhle des Homo naledi
Seit Lee Berger 2015 den Fund einer neuen Menschenart namens Homo naledi bekannt gab, ist er auch außerhalb der Fachwelt eine Berühmtheit. In der Rising-Star-Höhle in Südafrika hatte das Team des Paläoanthropologen Knochen und Zähne von mindestens 15 sehr kleinen Individuen gefunden, die zwischen 241.000 und 335.000 Jahre alt sind und die er keiner bekannten Menschenart zuordnen konnte. Er benannte sie schließlich nach dem Fundort. „Naledi“ bedeutet in der regional verwendeten Sprache „Stern“.
In kaum einer Wissenschaft ist die Konkurrenz so hart wie in der Archäologie. In dem relativ kleinen Fach buhlen viele um den nächsten Sensationsfund, der sich zumindest für eine Presseaussendung eignet. Lee Berger ging einen Schritt weiter: In der Netflix-Doku „Cave of Bones“ ließ er sich „exklusiv“ beim Entdecken filmen. Begleitet von einem Kamerateam kämpfte sich der Archäologe durch das unübersichtliche Höhlensystem und durch einen engen, fast vertikal abfallenden Schacht in die hinterste Kammer. Er wollte erstmals selbst an den schwer zugänglichen Ort, an dem seine mutigen Kolleginnen unzählige Knochenfragmente des Homo naledi gefunden hatten. Die Einblicke in die berühmte Rising-Star-Höhle sind faszinierend, doch im Lauf der Doku verkündet Berger eine steile These: Die frühen Menschen hätten ihre Toten unter größter Mühe in die hinterste Kammer geschleppt und dort bestattet. Sie hätten einen Friedhof angelegt, ganze 100.000 Jahre bevor die Homo sapiens auf diese Idee kamen. Zudem zeigt Berger stolz die Entdeckung einer Feuerstelle, einen mutmaßlichen Werkzeugstein und in die Steinwände der Höhle geritzte Zeichen. Zusammengenommen sind das Spuren einer fortschrittlichen Gesellschaft. Aber kann das stimmen?
Der Großteil seiner Fachkolleginnen beantwortet diese Frage mit nein. Bisher ist Lee Berger jeden Beweis schuldig geblieben, dass die Höhlenmalereien und die Feuerstelle tatsächlich vom Homo naledi stammen. Sie könnten ebenso das Werk von Homo sapiens sein, sagen Kritikerinnen. Zudem ist in keiner Weise gesichert, dass es sich bei der letzten Kammer um den ersten Friedhof der Menschenart handelt; die Toten hätten genauso gut bei einer Überschwemmung in den hinteren Bereich des Höhlensystems gespült werden können. Die wissenschaftliche Studie, die Berger zu dem Thema einreichte, wurde von der Fachwelt zerrissen. „Das Manuskript ist in seiner aktuellen Fassung als unvollständig und unzulänglich zu erachten“, schrieb etwa ein Gutachter, nachdem er eine lange Liste mit fehlenden Beweisen aufgezählt hat. Ein anderer Gutachter nennt die Vorgangsweise Bergers, die Studie trotz der verheerenden Kritik zu veröffentlichen, gar als „unverschämt“.
Auch die Wiener Archäologin Barbara Horejs hat die Netflix-Doku gesehen, und sie hält Bergers Behauptungen ebenfalls für sehr gewagt. Man müsse sich als Grabungsleiterin immer davor hüten, voreilige Schlüsse zu ziehen, sagt Horejs: „Es besteht immer die Gefahr, dass man seine Wünsche ausgräbt.“
Die Entdeckung von Poseidons Tempel
Seit Langem sind Archäologinnen und Archäologen jenem Tempel auf der Spur, den der griechische Autor Strabon in seinen „Geographika“ erwähnte. Strabon schrieb von einem Heiligtum, das dem Meeresgott Poseidon geweiht ist. Vermutet wurde es stets am Fuß der Festung Samikon an der Westküste der Peloponnes. 2017 begann ein Team um Birgitta Eder vom Österreichischen Archäologischen Institut der ÖAW das Gelände systematisch zu vermessen, bis es 2022 schließlich auf Gebäudereste stieß. Nach und nach legten die Forscherinnen die Fundamente eines 9 x 28 Meter langen Baus frei, der zwei Innenräume sowie eine Tempelvorhalle und eine Rückhalle aufwies. Auch Fragmente des Dachs tauchten auf und ein kultisches Wasserbecken aus Mamor, ein sogenanntes Perirrhanterion.
Damit stand für Grabungsleiterin Birgitta Eder fest: „Bei dem lang gestreckten Großbau handelt es sich um einen archaischen Tempel, der auf dem Gelände des Poseidonheiligtums lag und vielleicht sogar dem Gott selbst geweiht war.“ Stammen dürfte der Tempel aus dem archaischen Zeitalter, das von etwa 800 bis 500 vor Christus reichte. Eder und ihr Team vermuten, dass es das Heiligtum bereits im sechsten vorchristlichen Jahrhundert gab. Das Forschungsprogramm rund um Poseidons Heiligtum läuft noch vier Jahre, weitere Erkenntnisse sind also zu erwarten.
Die Rezepte aus der Mumienwerkstatt
Vor gut 100 Jahren wurde das Grab des Tutanchamun mit seiner weltberühmten Mumie entdeckt. Trotz intensiver Forschung verstand man bisher aber nur in Ansätzen, wie die alten Ägypter ihre Toten einbalsamierten. Nur so viel war bisher klar: Sie entnahmen Gehirn und Organe, entzogen dem Körper mit Natron die Flüssigkeit, rieben ihn anschließend mit Harzen und Fetten ein, um den Verfall zu stoppen – und wickelten die Leiche schließlich in Leinenbinden. Bis zu 70 Tage nahm das Prozedere in Anspruch.
Die Entdeckung einer Mumienwerkstatt in der Totenstadt Sakkara südlich von Kairo hat nun gezeigt, welche Rezepturen die Bestatter damals verwendeten. Ein Team um den 2022 verstorbenen Ägyptologen Ramadan Hussein von der Uni Tübingen fand Tongefäße aus dem siebten und sechsten Jahrhundert vor Christus, einst gefüllt mit Substanzen zum Einbalsamieren. Fast alle der 121 Schalen und Becher unterschiedlichster Größen waren beschriftet, 31 davon konnte das Team der Uni Tübingen bisher entziffern. So stand etwa auf einem Gefäß: „An den Kopf zu geben.“ Darin befanden sich die Spuren einer Mixtur aus Ölen von Zypressen, Zedern, dem Elemi-Baum, außerdem tierisches Fett, Bienenwachs sowie Rizinusöl. „Schützt den Bauch“ stand wiederum auf Gefäßen, an denen die Reste von Bienenwachs klebten. In Schalen mit der Aufschrift „Behandlung der Bandagen, Wickel oder Einbalsamierung“ befanden sich Spuren von Zypressenöl und Tierfett.
Manche Schalen waren auch mit Handlungsanweisungen beschriftet, etwa „damit waschen“, „einwickeln“ oder „um seinen Geruch angenehm zu machen“. Die Bestatter in Sakkara wussten, was sie taten: Die verschiedenen Mischungen hemmen tatsächlich das Wachstum von Bakterien und Pilzen in toten Körpern. Wasserabweisende Stoffe wie das aus dem Toten Meer stammende Mineralöl Bitumen sollten die Hautporen verschließen, andere wie Bienenwachs die Haut geschmeidig halten.
Auch Irrtümern kamen die Forscherinnen in Sakkara auf die Spur: Die von den Ägyptern als „antiu“ bezeichnete Substanz übersetzte die Fachwelt bisher mit Myrrhe oder Weihrauch. Tatsächlich verbirgt sich hinter dem Begriff ein spezifisches Gemisch aus Zedern- und Zypressenöl sowie tierischen Fetten.
Besonders überraschend war für Grabungsleiterin Susanne Beck die Herkunft der Inhaltsstoffe. So fanden sich in vielen Rezepten die Harze von Elemi- und Dammar-Bäumen – das sind Gewächse, die ausschließlich in den Tropen vorkommen, etwa in Afrika und in Südostasien. Insgesamt stammte der größte Teil der Substanzen nicht aus Ägypten, sondern aus dem Mittelmeerraum, aus Afrika und Südostasien. Das bezeugt den riesigen Aufwand, den die Ägypter mit ihrer Totenkult-Industrie vor fast 3000 Jahren betrieben . „Vermutlich hatte die ägyptische Mumifizierung letztlich einen wichtigen Anteil daran, dass es zu einer frühen, weltweiten Vernetzung kam“, sagt Grabungsleiterin Beck.
Die neue Geschichte des Alphabets
Auf dem antiken Zettel notierte jemand zwei Worte: Honig und Sklave. Oder, rückwärts gelesen, könnte das Wort für Honig auch eine Ableitung des Verbs „drehen“ sein. Gefunden hat die vier Zentimeter kleine Scherbe Felix Höflmayer vom Archäologischen Institut der ÖAW in der Ausgrabungsstätte von Tel Lachisch in Israel. Das Keramikstück gehörte zu einer aus Zypern importierten Schale, deren Innenseite mit Buchstaben aus dunkler Tinte beschriftet ist. „Die Scherben verwendeten die Menschen schon mal, um sich schnell etwas aufzuschreiben“, sagte Höflmayer der „Süddeutschen Zeitung“.
In der Fachwelt sorgten die Buchstaben für Aufsehen: Bisher hatte man gedacht, dass sich das Alphabet mit der ägyptischen Herrschaft im 14. oder 13. Jahrhundert vor Christus in der Südlevante verbreitete (die Levante ist das Gebiet östlich des Mittelmeers zwischen der heutigen Türkei und Ägypten). Die aus dem Jahr 1450 vor Christus stammende Scherbe zeigt nun aber, dass die Schrift bereits zu einer Zeit in der Region um Lachisch verbreitet war, als die Ägypter diese noch nicht beherrschten. Durch das Fundstück müsse die Entstehung und Verbreitung des frühen Alphabets im Nahen Osten neu überdacht werden, sagt Höflmayer.
Erfunden wurde das Alphabet übrigens nicht von Gelehrten, sondern von beduinischen Arbeitern, die um 1800 vor Christus für die Ägypter auf der Halbinsel Sinai Kupfer und Türkis abbauten. Sie bedienten sich der Hieroglyphen ihrer Auftraggeberinnen, vereinfachten sie und entwickelten ihr eigenes Alphabet. Früher als bisher angenommen verbreiteten sich die frühen Buchstaben dann in die Levante und entwickelten sich schließlich zum griechischen und lateinischen Alphabet.
Das Show-Weingut der römischen Kaiser
Die Herrscher im alten Rom liebten Wein – und romantisierten gleichzeitig die Arbeit bei dessen Herstellung. Der Kaiser selbst eröffnete jedes Jahr die Weinernte, indem er symbolisch eine Rebe abschnitt und dem Gott Jupiter ein Lamm opferte. Der spätere Herrscher Marcus Aurelius beschrieb, wie er einer solchen Zeremonie als junger Mann beiwohnte: „Ich begleitete meinen Vater bei dem Opfer. Dann ging ich zum Mittagessen. Danach machten wir uns daran, die Trauben zu ernten. Wir schwitzten und waren vergnügt.“ Nach einem Bad lauschten Vater, Sohn und ihre Gäste „fröhlich dem Geschwätz der Landarbeiter“, die die Trauben stampften.
An der Via Appia, wenige Kilometer vor Rom, gruben Archäologen 2018 einen luxuriösen Landsitz aus, auf dem römische Herrscher einige Zeit nach Marcus Aurelius’ idyllischem Nachmittag ähnliche Spektakel vollzogen. An der sogenannten Villa der Quintilier fand ein Team um Emlyn Dodd ein ungewöhnliches Weingut vor: Dessen Grundriss ähnelt eher einem Freilichttheater als einem Gutshof. Von pompös eingerichteten Speisesälen aus konnten die Herrscher und ihre Gäste die Weinproduktion beobachten. Flankiert wird die 1000 Quadratmeter große Anlage von zwei großen Weinpressen, in deren Zentrum sich der Platz befindet, auf dem die Arbeiter, vermutlich Sklaven, mit ihren Füßen die Trauben zerquetschten. Anders als bei richtigen Weingütern war der Boden hier aber nicht mit Zement, sondern mit Marmor ausgelegt, der durch den Traubensaft unweigerlich zur Rutschpartie wurde. Das Weingut weise insgesamt eine „bizarre Opulenz auf, die man in normalen Produktionsstätten niemals sieht“, schreibt Emlyn Dodd von der University of London in dem renommierten Fachblatt „Antiquity“.