
Drei Personen sitzen in einem Fernsehstudio mit dem Schriftzug „Spontan gefragt“ im Hintergrund.
Wichtige Erkenntnisse klar kommunizieren
Sie sind weltweit stark verbreitet: Studien zufolge werden etwa 80 Prozent aller Frauen und Männer im Lauf ihres Lebens mit Humanen Papillomaviren (HPV) infiziert. Diese große Virusgruppe – bekannt sind mehr als 200 verschiedene Typen – kann zu einem abnormen Zellwachstum führen, was wiederum Krebs verursachen kann. Die gute Nachricht: Es gibt eine Impfung gegen HPV-Viren. Im Wissenschaftstalk „Spontan gefragt“ geht Moderator Markus Hengstschläger mit seinen Gästen der Sache auf den Grund, warum es so schwierig ist, über die Erkrankung zu reden. Doch zunächst will er von Univ.-Prof. Andreas Bergthaler wissen, warum HPV ein Tabuthema ist. „Das HPV-Virus ist ein evolutionärer Meister seines Faches, denn es kann den Wirt, den Menschen, chronisch infizieren“, erwidert der Virologe. „In der Regel passiert nichts, in manchen Fällen aber schon – es kann Krebsarten hervorrufen.“ Am häufigsten sei Gebärmutterhalskrebs, aber Anal-, Peniskrebs oder Mund-Rachen-Krebs zählten auch dazu. „Dass es primär über sexuelle Kontakte übertragen wird, macht es zu einem stigmatisierten Thema, über das man nicht so gerne redet“, schließt der Wissenschafter. Das will Vera Russwurm genauer wissen: „Wie kann es noch übertragen werden?“, fragt die ORF-Talkmasterin. „Im Prinzip immer, wenn die Haut von Menschen aufeinandertrifft“, präzisiert Andreas Bergthaler. „In seltenen Fällen kann es auch bei der Geburt passieren, dass eine HPV-infizierte Mutter das Virus weitergibt. Aber man geht davon aus, dass sexuelle Kontakte die Hauptübertragungsroute sind.“ Ob es darum in seinem vom WWTF geförderten Forschungsprojekt gehe, will Markus Hengstschläger wissen. Dieses habe drei Dimensionen, sagt Bergthaler. „Einerseits arbeiten wir bei HPVienna mit einer Wiener Klinik zusammen, die sich auf Patient*innen fokussiert hat, die keine Gesundheitsversicherung haben“, so der Forscher. „Wir werden vor Ort die Thematik mit ihnen bearbeiten – in Form soziologischer Umfragen, es werden Abstriche genommen und Viren sequenziert.“ Gleichzeitig werden Abwasseranalysen durchgeführt. Bergthaler: „Es ist technisch erst jetzt möglich, HPV-Viren im Abwasser zu detektieren.“ Im dritten Schritt werden die Daten zusammengeführt. „Gemeinsam mit Mathematiker*innen modellieren wir diese dann“, so der Virologe. „Was konkret bringen die Ergebnisse dieser Forschung der Bevölkerung“, fragt Vera Russwurm nach. „Das Modellieren kann man sich wie ein Computerspiel vorstellen“, erklärt Bergthaler. „Es wird eine Stadt statistisch berechnet, der bestimmte Informationen zugeordnet werden.“ So könne man darstellen, wie sich das HPV-Virus über verschiedene Bevölkerungswege überträgt. „Letztlich kann man so simulieren, was passiert, wenn nicht nur 50, sondern 75 Prozent der Einwohner*innen geimpft sind“, betont er. „So erkennt man Möglichkeiten, um das Übertragungsrisiko zu minimieren.“

Ein Mann mit Brille, Anzugjacke und Jeans steht vor einem Vorhang.
Andreas Bergthaler
Andreas Bergthaler
Der Forscher studierte zunächst Veterinärmedizin an der Vetmeduni Wien. Bereits als Student sammelte er berufliche Erfahrung in Wien, Edinburgh, Kopenhagen und Tokyo, wo er an der University of Tokyo bei Tadatsugu Taniguchi erstmals in den Bereich der Immunologie vordrang. Sein Doktorat absolvierte Bergthaler bei Hans Hengartner und Nobelpreisträger Rolf Zinkernagel am Institut für Experimentelle Immunologie an der Universität Zürich. Als Postdoctoral Fellow arbeitete er an der Universität Genf sowie am Institute for Systems Biology in Seattle. Bergthaler habilitierte sich für das Fach der Virologie an der MedUni Wien. Ab 2011 leitete der Virologe eine Forschungsgruppe am CeMM Forschungszentrum für Molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Seit 2022 ist er Professor für Molekulare Immunologie und Leiter des Instituts für Hygiene und Angewandte Immunologie am Zentrum für Immunologie (ZPII) der MedUni Wien.
Kommunikation verbessern
Markus Hengstschläger kommt auf die HPV-Impfung zu sprechen. „Wie steht Österreich denn diesbezüglich da?“, will er wissen. Bei den 14-Jährigen sei mittlerweile jede*r Zweite geimpft, erwidert Andreas Bergthaler. „Wir stehen also relativ gut da“, so der Virologe. „Aber natürlich ist da noch Spielraum nach oben.“ Dazu hat Vera Russwurm eine Frage. „Jede Impfung birgt ein Risiko, aber wenn man vergleicht, was dabei passieren kann und was Ungeimpften passieren kann, geht es eindeutig pro Impfung aus“, sagt die Moderatorin.

Eine Frau mit braunen Haaren lächelt in einem weißen Pullover in die Kamera.
Vera Russwurm
Vera Russwurm
Die studierte Medizinerin hat in der deutschsprachigen TV-Landschaft eine beispiellose Karriere hingelegt: Mit 18 per Zufall vom ORF entdeckt, wird sie zur Moderatorin der Jugendsendung „Okay" und kurz darauf zur „Traumfrau der Jugend" gewählt. Mit 25 eröffnet sie den Drei-Länder-Sender 3-SAT, mit 26 übernimmt sie die Moderation großer Live-Co-Produktions-Shows des ORF mit ARD und ZDF und gründet in Folge gemeinsam mit ihrem Mann Peter Hofbauer und ihrem Bruder Heinz die TV-Produktionsfirma „Hofpower". Nach der Geburt ihres ersten Kindes gibt sie ihr Engagement in Deutschland ebenso auf wie die großen Unterhaltungsshows. Stattdessen wechselt sie ins Infotainment und etabliert die erste österreichische Talkshow: „VERA". Ende 2023 – nach 45-jähriger, durchgehender TV-Präsenz – beendet die TV-Ikone ihre 30-jährigeTalkshow-Reihe. Vera Russwurm wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet: Sie gewann u. a. den „Frauen-Oscar", drei Mal den KURIER-Publikumspreis „Romy" sowie den New-York-TV-Award in der Kategorie „Beste Talkshow".
„Was sind die Risken der HPV-Impfung?“ Die seien gering, erwidert der Wissenschafter. „Abgesehen von lokalen Impfreaktionen wie Kopfweh, Fieber oder geschwollenen Lymphknoten, was letztlich alles Zeichen sind, dass das Immunsystem anspringt, ist nicht viel bekannt.“ Markus Hengstschläger bringt in diesem Zusammenhang ein weiteres Thema zur Sprache. „Während der Pandemie gab es nicht nur Impfgegner, sondern auch das, was wir als Wissenschaftsskepsis bezeichnen“, sagt er. „Woher kommt sie?“ Das könne sie nicht sagen, antwortet Vera Russwurm. „Mir ist Wissenschaftsskepsis völlig unklar, da wir alle von neuen Erkenntnissen profitieren“, sagt sie. „Viele Begriffe aus der Wissenschaft sind aber auch schwer zu verstehen.“ Es gebe so etwas wie ein Präventionsparadoxon, erwidert Andreas Bergthaler. „Wir wissen, es existiert eine potenzielle Gefahr, wappnen uns dagegen, und dann tritt diese Gefahr nicht ein“, sagt er. „Dann heißt es im Nachhinein: Ihr habt über das Ziel hinausgeschossen.“ Prävention sei bei Impfungen und Infektionserkrankungen schwer zu verkaufen, resümiert der Virologe. Man müsse die Argumente schärfen und sie so vorbringen, dass sie verständlich sind, merkt Markus Hengstschläger an: „Wissenschaft muss man auf Augenhöhe erklären, da bleibt gar nix anderes übrig.“ Dem kann Andreas Bergthaler nur zustimmen: „Wissenschaft wird zum Großteil vom Staat finanziert, und daher sind wir verpflichtet, den Steuerzahler*innen, die unsere Arbeit finanzieren, zu zeigen, dass sie ihnen etwas bringt“, sagt er. „Ich glaube, dass Wissenschaftskommunikation Teil des Jobs als Forscher sein muss.“ Vera Russwurm betont, dass sich ihrer Meinung nach die Kommunikation bereits verbessert habe. „Worin siehst du Wissenschaftsskepsis begründet“, will sie von Markus Hengstschläger wissen. „Ich glaube, es ist uns zu wenig gelungen, zu erklären, wie Wissenschaft funktioniert“, antwortet dieser. „Wir haben die Fakten präsentiert. Was die Menschen aber wissen müssen, um unseren Weg mitzugehen, ist, wie es zu den Ideen und Ergebnissen kommt. All diese Prozesse müssen mitkommuniziert werden.“
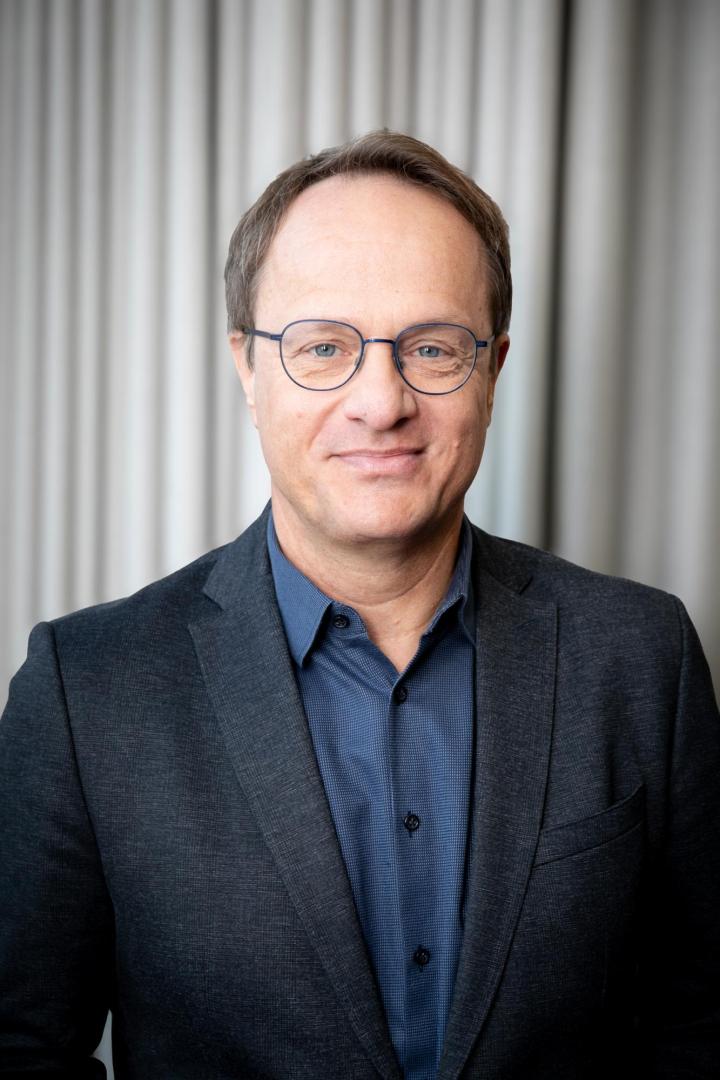
Ein Mann mit Brille und dunklem Anzug vor einem hellen Hintergrund.
Markus Hengstschläger
Markus Hengstschläger
Univ.-Prof. Dr. Markus Hengstschläger studierte Genetik, forschte auch an der Yale University in den USA und ist heute Vorstand des Instituts für Medizinische Genetik an der Medizinischen Universität Wien. Der vielfach ausgezeichnete Wissenschafter forscht, unterrichtet Studierende und betreibt genetische Diagnostik. Er leitet den Thinktank Academia Superior, ist stellvertretender Vorsitzender der österreichischen Bioethikkommission, Kuratoriumsmitglied des Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Stammzellforschung. Er war zehn Jahre lang Mitglied des Rats für Forschung und Technologieentwicklung und Universitätsrat der Linzer Johannes Kepler Universität. Hengstschläger ist außerdem Unternehmensgründer, Wissenschaftsmoderator, Autor von vier Platz-1-Bestsellern sowie Leiter des Symposiums „Impact Lech“.

