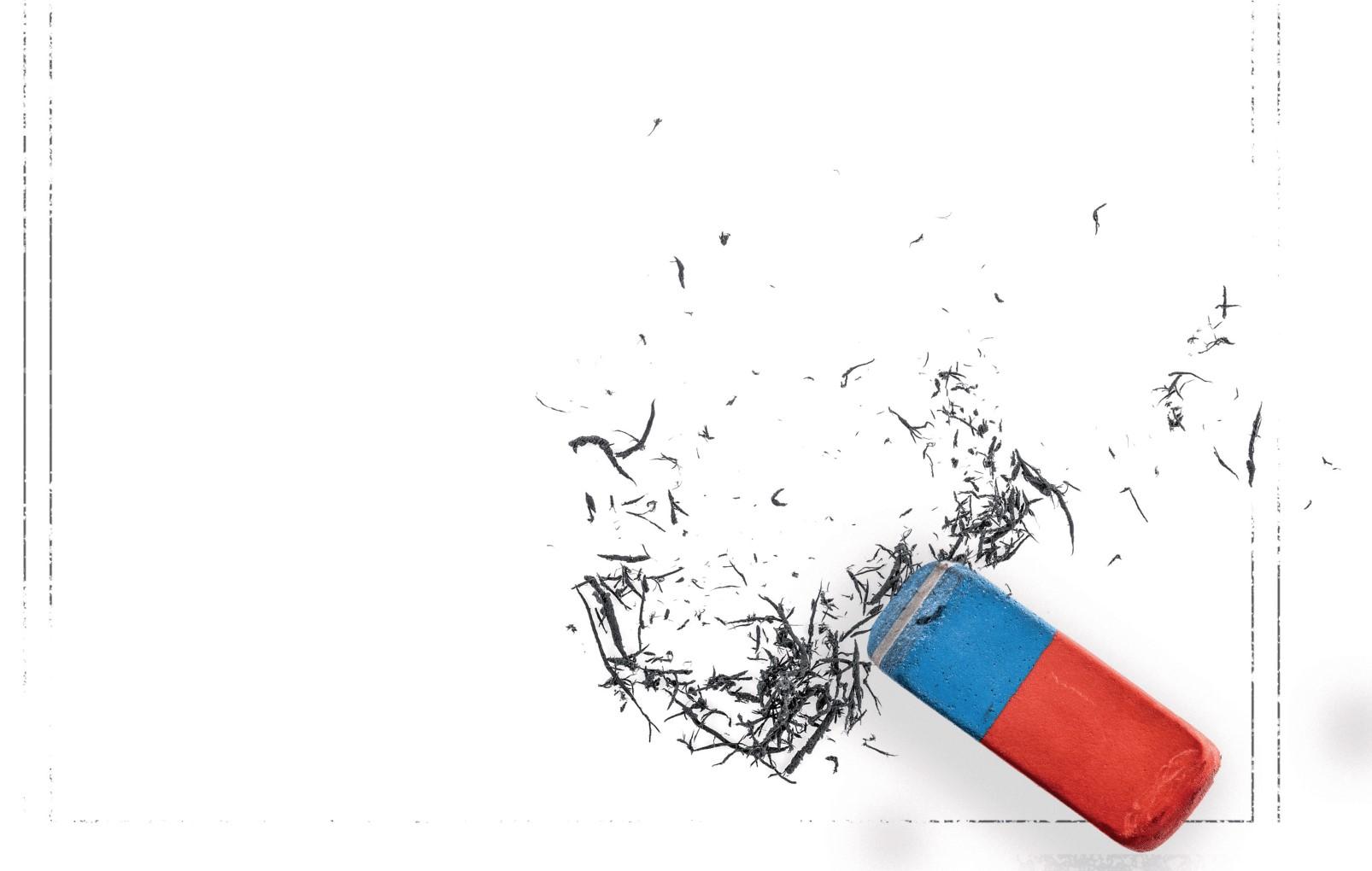
Cancel Culture: Rumpelstilzchen zerreißt sich selbst
Mit „RIP J.K. Rowling“-Tweets wurde dazu aufgerufen, die Bücher von J.K. Rowling buchstäblich zu Grabe zu tragen, nachdem die britische „Harry Potter“-Bestsellerautorin mit Online-Kurznachrichten über Trans-Menschen für heftige Kontroversen gesorgt hatte. Schauspielerinnen und Schauspieler werden aus Filmen, Liebesgedichte von Hauswänden und Autorinnen und Autoren aus Diskussionsveranstaltungen entfernt. „Cancel Culture“ ist das politische Schlagwort der Stunde. Es bezeichnet, grob als Streich- oder Abbruchkultur ins Deutsche übersetzt, den Versuch, vermeintliches Fehlverhalten, herabsetzende oder diskriminierende Aussagen oder Handlungen häufig prominenter Personen öffentlich und mit den Mitteln von Boykott und Isolierung zu ächten. Vor allem auf den unterschiedlichen Plattformen der sozialen Medien tobt und rumort es in Dauererregung: Während sich die einen darüber beklagen, kann es den anderen gar nicht weit genug gehen. Der deutsche Philosoph und Kulturwissenschafter Johan Frederik Hartle, seit 2019 Rektor der Akademie der bildenden Künste am Wiener Schillerplatz, fordert deshalb ein „Bürgerrecht auf Kritik“. Hartle schreibt: „Hoffentlich bleibt uns die Kultur der Kritik erhalten – in den (sozialen) Medien, an Universitäten, in Kulturinstitutionen und darüber hinaus.“ Ein Essay wider die rasche Skandalisierung in dauerskandalisierter Zeit.
Wir befinden wir uns inmitten einer großen Suche nach Orientierung. Das suggeriert die Vehemenz, mit der politisch gestritten wird, oder besser: mit der politischer Streit unterbunden wird. Es wird beleidigt und diffamiert, es wird das Rederecht entzogen und – aufgrund von bestimmten Eigenschaften – die legitime Teilhabe am politischen Diskurs abgesprochen. Oft wird an das gegenseitige Schamgefühl appelliert, und vieles mündet im Skandal. Es ist eine hochmoralisierte Situation, und an vielen Stellen wird Kritik durch Diffamierung ersetzt. In diversen Medien werden Wissenschafterinnen und Künstler nicht mit Verweis auf ihre Positionen und Leistungen porträtiert, sondern mit Blick auf ihre politischen Meinungen. Auch darüber, welche wissenschaftlichen Positionen an Universitäten verhandelt werden dürfen, möchten Aktivistinnen und Aktivisten auf Social Media und skandalisierende Presse allzu häufig gerne mitentscheiden. Das meint der Begriff „Cancel Culture“, der ursprünglich von rechts zur Diffamierung linker Gleichheitsansprüche an das Kulturerbe geprägt wurde. De facto wird von rechts ebenso gecancelt wie von links und aus der Mitte.
Für all das gibt es Gründe: Im demokratischen Prozess sind Freiheit der Rede, Mehrheitsprinzip und Minderheitenschutz fein abzuwägen. Es ist gut, dass es Regeln gibt, dass gerahmt wird, kontextualisiert, kommentiert und vor allem: kritisch geprüft wird. Und manche Diskussionen sollte man auf bestimmte Weisen zu bestimmten Zeiten vielleicht in der Tat nicht führen. Aber welche Regeln braucht es genau? Gelten für immer und überall dieselben? Sollten solche Regeln dazu beitragen, uns von der Ambivalenz politischer Biografien und Positionen zu befreien? Dürfen sie zu Redeverbot führen? Zu einem Index von Personen, die nicht mehr zu Wort kommen dürfen? Reichen spezifische Rahmungen von heiklen Diskursen, um eine Kultur der Auseinandersetzung zu gewährleisten?
Johan Frederik Hartle
wurde 1976 in Hannover geboren und ist seit 2019 Rektor der Akademie der bildenden Künste Wien. Zuvor war er interimistischer Rektor an der staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, wo er auch eine Professur für Kunstwissenschaft und Medienphilosophie innehatte. Er lehrte unter anderem an der Universität von Amsterdam und der China Academy of Art und war Forschungsstipendiat in Rom und Jerusalem.
Jenseits der Entwicklungen in der demokratischen Öffentlichkeit stehen die Tatsachen, dass die Lebensgrundlagen auf diesem Planeten infrage gestellt sind und dass die geopolitische Ordnung der letzten Jahrzehnte im Streit der großen Machtblöcke zerrieben wird. Durch sie wird das Tabu gewissermaßen objektiv, denn weitermachen wie bisher, das geht nicht mehr. Es bleibt aber offen, was aus dem objektiven Scheitern der bisherigen Routinen zu lernen ist.
Vieles entzündet sich an der Welt der „alten weißen Männer“ und daran, wie marginalisierte Gruppen bezeichnet, dargestellt oder imitiert werden – das Auftrittsverbot für eine junge Musikerin mit Dreadlocks und die Cancel-Debatte zu Winnetou waren hier die vorläufigen Höhe- oder, je nach Perspektive, Tiefpunkte. Vieles artikuliert sich als Tabu und als Regelwerk für die eigene Sprache und die individuelle Lebensführung. Zugleich schallt durch die etablierten Medien die selbstwidersprüchliche Beobachtung, „dass man dies und das ja heute gar nicht mehr sagen darf“. Das ist nachweislich falsch: Was zählt ist die Bubble, in ihr darf jeder Sherlock-Humbug seine eigenen Rumpelstilzchentänze aufführen. In der je eigenen Blase ist es leicht, sich vor anderen Positionen zu schützen. Kontroversen lassen sich durch Diffamierung vermeiden. Sie schützt auch vor Lernerfolgen.
Man stelle sich eine Zeitmaschine vor, die aus heutiger Sicht einen Vortrag der 1950er-Jahre ankündigt: „Universität lädt Kritikerin der schwarzen Bürgerrechtsbewegung ein“ – gemeint wäre Hannah Arendt, die in der Tat in einem Artikel die Bürgerrechtsbewegung kritisierte und für antikoloniale Befreiungsbewegungen kein Verständnis zeigte. In ihrem Vortrag hätte sie vielleicht über eine Philosophie der Technik gesprochen und gar nicht über Fragen rassistischer Unterdrückung. Sollte sie trotzdem zu Wort gekommen sein?
Es ist eine hochmoralisierte Situation, und an vielen Stellen wird Kritik durch Diffamierung ersetzt.
Es ist nicht schwer, den überlieferten kanonischen Diskursen Komplizenschaft mit Kolonialismus und der Unterdrückung nicht männlicher, nicht binärer Genderidentitäten, die Kontinuität von kolonialer Unterdrückung nachzuweisen. Es ist auch eine wichtige Arbeit, das zu tun. Die Frage ist, mit welchem Ziel. Es lohnt sich deswegen, über den Unterschied zwischen Diffamierung und Kritik nachzudenken. Genauer: Es lohnt sich, die Tradition „immanenter Kritik“ in Erwägung zu ziehen. Immanente Kritik misst die Gegenstände an ihrem eigenen Anspruch. Sie ist zugleich das Wissen um die Notwendigkeit, dass etwas, auch und gerade um sich selbst gerecht zu werden, über sich selbst hinausgetrieben werden muss. Liberale und progressive Diskurse sind auf das aufklärerische Apriori der Gleichheit verpflichtet, dem sie in Wahrheit oft widersprechen. Anspruch und Wirklichkeit fallen jeweils auseinander. Das ist ein guter Ausgangspunkt. Die Idee der immanenten Kritik geht auf die Philosophie Hegels zurück, dessen Denken tief eurozentrisch und von preußischer Selbstherrlichkeit geprägt war. Auch er musste über sich hinausgetrieben werden.
Der Widerspruch zwischen Ansprüchen und Wirklichkeit – zum Beispiel von Gleichheit, Demokratie etc. – hat Geschichte. Die antike Stadtgemeinschaft der Athener, in der die moderne Demokratie ihre Wurzeln hat, sah Frauen, Sklavinnen und Sklaven nicht vor, erkannte sie nicht als gleichberechtigte Mitglieder der Gemeinschaft an. Freie und Gleiche gab es damals schon, aber eben nur Männer, die der Gemeinschaft angehört haben. Sklavinnen und Sklaven waren vor allem die Unterworfenen jener Stämme, gegen die das antike Athen Krieg geführt hatte, sozusagen Opfer kolonialer Raubzüge. Die großen griechischen Philosophen (fast ausschließlich Männer) störten sich kaum daran, wenn sie von Tugenden und guter Lebensführung schrieben.
Die Französische Revolution, ein Gründungsakt der Moderne, hat die Gleichheit (mit der Freiheit und der, in der Tat, durchaus nicht geschlechtsneutralen Brüderlichkeit) großgeschrieben. Die Erklärung der universalen Menschenrechte im Jahr 1789 war eine ihrer Folgen. Im fernen Haiti führten diese Grundsätze zu manifesten Ansprüchen und zu zahlreichen Revolten. Für wen genau diese Menschenrechte denn gelten, fragten die Sklavinnen und Sklaven im Umfeld von Toussaint Louverture, der die Aufstände koordinierte, die 1794 zur Abschaffung der Sklaverei führten und der als „schwarzer Jakobiner“ in die Geschichte einging. Denn offenbar hat Gleichheit in der europäischen Kulturtradition stillschweigend immer auch Grenzen enthalten und ihre Wirkungen fortgeschrieben.
Viele alte weiße Männer werden derzeit von ihren Sockeln gestoßen, weil sie Sklavenhändler, Rassisten oder erklärte Antisemiten waren. David Hume, Schlüsselfigur der britischen Aufklärung, verkehrte mit Sklavenhändlern, Immanuel Kant, der das „Zeitalter der Kritik“ beschwor und das Denken auf nicht dogmatische Vernunftgrundsätze stellte, formulierte Beiträge zu einer Rassentheorie. Wer möchte sie für ihre Verbrechen und Ideologien verteidigen? Dennoch ist die Suche nach Reinheit in der Auseinandersetzung mit Traditionsbeständen trügerisch. Die Alternative der Geschichtsvergessenheit ist kaum verheißungsvoller, wenn wir nicht mehr aus Traditionen schöpfen können, um unsere Auseinandersetzungen bilderreich und mit Verweis auf das Scheitern und Gelingen früherer Argumente zu führen, eben weil die Urheber dieser Argumente diskreditiert sind.
Dabei sind die Wege der Rezeption unübersichtlich und mehrdeutig. Martin Heidegger, der mit den Nazis paktierte und weit darüber hinaus, das belegen seine Notizbücher, die „Schwarzen Hefte“, ein offener Antisemit war, konnte zu einer zentralen Inspiration nicht nur für Hannah Arendt, sondern auch für Herbert Marcuse, Jacques Derrida oder Emmanuel Lévinas werden, die allesamt jüdisch waren – ebenso für Jean-Paul Sartre, der wiederum Mitglied der Résistance war.
In der je eigenen Blase ist es leicht, sich vor anderen Positionen zu schützen. Kontroversen lassen sich durch Diffamierung vermeiden. Sie schützt auch vor
Lernerfolgen.
In seiner Einleitung zu Frantz Fanons „Die Verdammten dieser Erde“, einem Klassiker der postkolonialen Literatur, beschrieb Sartre jene Augenblicke, in denen die hochtönenden Lehren der weißen Kolonisatoren von den Kolonisierten ernst genommen werden. Sein Anlass war der Algerienkrieg. Aber auch das Beispiel der haitianischen Revolution ist ein hervorragendes. Das Argument lässt sich ohne große Anstrengung auf andere Kämpfe um Gleichheit und Teilhabe am demokratischen Prozess übertragen: die Politisierung des Arbeitsplatzes, der Erziehung und der Familie, die Politisierung der geschlechtlichen Identität, von Flüchtlingscamps und so weiter. Immer wieder haben sich Räume aufgetan, in denen politische Subjekte entstanden sind, die zuvor nicht als solche gedacht wurden und die einen eigenen Anspruch angemeldet haben.
Die Geschichte hält viele Ansprüche bereit, die rückblickend, im Licht der historischen Tatsachen, als beinahe zynisch vernachlässigt erscheinen. Dennoch sind sie diskursgeschichtlich in vielerlei Hinsicht unabgegolten, das heißt weder realisiert noch in ihren Ansprüchen vollständig erloschen. Noch immer kann man die reale geschichtliche Praxis und einzelne Positionen an ihren eigenen Ansprüchen messen, ohne es von außen, von einem imaginierten Idealstandpunkt, besser zu wissen und dann Deutungen und Wertungen überzustülpen. Hannah Arendt beispielsweise hat viele gute Ideen für eine republikanische Demokratietheorie formuliert. Man könnte ihr eigenes Denken an diesen eigenen Ansprüchen messen, wo es nicht konsequent gegen Kolonialismus und Rassismus andenkt. Die Philosophinnen Iris Därmann und Juliane Rebentisch haben das getan.
Eine solche Form der Kritik ist besser als das Tabu und intelligenter als gegenseitige Skandalisierung. Leider kostet sie Zeit und Mühe, weil man die Position, die man kritisiert, erst einmal kennen muss. Einzelne Aussagen, die online kolportiert werden und die für eine rasche Skandalisierung taugen, reichen dafür kaum aus.
Anders als „die alten Griechen“ haben wir das historische Glück, dass wir – mit Ausnahme weniger Fundamentalistinnen und Fundamentalisten – in einer noch so zynischen und aus den Fugen geratenen Welt auf gemeinsame Postulate sozialer Normen zurückgreifen können und auf Institutionen, die sie manifestieren. Das stimmt sogar für diejenigen skandalisierten Personen, die an diversen Diskursen oder politischen Entwicklungen gescheitert sind, weil sie falsche Meinungen vertreten haben. Auch sie unterliegen denselben Begründungsansprüchen und können dazu gebracht werden, über sich hinauszudenken. Auch sie haben ein Bürgerrecht auf Kritik. Hoffentlich bleibt uns die Kultur der Kritik erhalten – in den (sozialen) Medien, an Universitäten, in Kulturinstitutionen und darüber hinaus.


