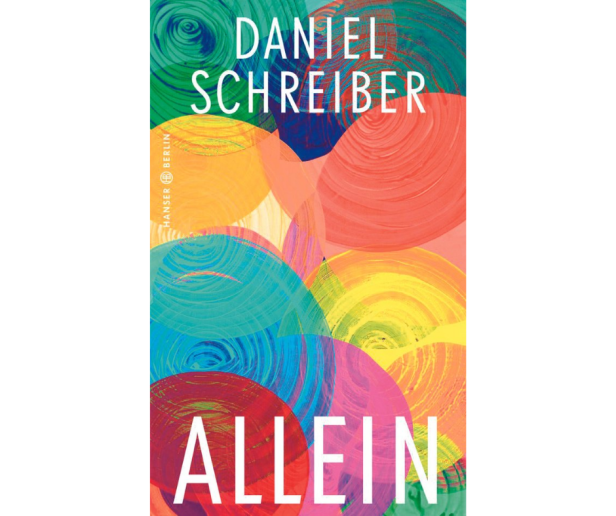Einsamkeit: Praktiken der Selbstreparatur
Bingen Sie schon oder leben Sie noch? In jedem Fall wissen Streaming-Junkies, dass Einsamkeit ein Grundgefühl etlicher Serien-Protagonisten ist. Gibt es jemand einsameren als Kendall Roy, den bipolaren verstoßenen Kronprinzen aus der brillant perfiden Mediendynastie-Serie „Succession“?
Beklemmend jene Szene, in der Jeremy Strong (der als neuer De Niro gehypte Darsteller dieses tragischen Narzissten) von seiner eigenen, durchaus monomanischen Geburtstagsparty flüchtet, weil er „keine Connection“ zu seinen Gästen fühlen kann. Ganz ähnlich ergeht es auch (Achtung, Spoiler) der frisch verwitweten Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) in der ziemlich grottigen „Sex and the City“-Reanimation „And Just Like That …“ in jenem Moment, als sie noch einen letzten Gang durch die vormals gemeinsame Wohnung tut, ehe diese auf den Markt kommt.
Dass Einsamkeit zum seelischen Massenphänomen wird, berichten Soziologen, Psychiater und Psychologen seit Jahren. Die Isolations- und Abstandskrise der vergangenen Monate hat das Phänomen nur noch verstärkt. Der 1977 geborene und in der DDR aufgewachsene Autor Daniel Schreiber hat nun zu dem Phänomen den facettenreichen Essay „Einsamkeit“ geschrieben – und dabei gleich ein eigenes Genre kreiert.
Aus der Perspektive eines schwulen weißen Mannes beschreibt er jene Form „von grausamem Optimismus“, der ihn noch immer an ein offenes Haus mit Garten und Zweisamkeit glauben lässt (zumindest hat er das seinem Therapeuten auf die Lebenswunschliste geschrieben), setzt sich aber auch mit den abstrusen Eigenheiten einer Gesellschaft auseinander, die das Fehlen einer klassischen Liebesbeziehung als „persönliches Scheitern“ und Folge von „mangelnder Attraktivität, mangelndem wirtschaftlichen Erfolg und mangelnder physischer Fitness“ betrachtet.
Wie schon die israelische Soziologin Eva Illouz in ihrem Bestseller „Warum Liebe weh tut“ ist auch Schreiber überzeugt, dass der Freundschaft viel zu wenig Anerkennung zuteilwird: „Wenn man allein lebt, sind es oft Freundschaften, die das Zentrum des Lebens bilden. Die Beziehungen zu vielen meiner Freundinnen und Freunde haben länger gehalten als meine längsten Partnerschaften. Sie sind die Quelle meiner größten Konflikte und meines größten Glücks. Meine älteste Freundin ist über siebzig, meine jüngste Mitte zwanzig. Es sind Freundschaften, die mein Leben strukturieren.“
Angesichts der Brüchigkeit von Paarbeziehungen ist man wohl gut damit bedient, selbst im Status der Zweisamkeit ein Arsenal von Freundschaften zu bewahren. Schreiber zitiert die Soziologin Sasha Roseneil (sein Essay ist auch ein wunderbares Schlendern durch alle möglichen wissenschaftlichen und literarischen Disziplinen), die der Meinung ist, dass Freundschaften zu „Praktiken der Selbstreparatur“ werden. Sie können dabei helfen, „die Wunden des Selbst zu heilen“ und „seelischen Nöten, Enttäuschungen, psychischem Leid und Verlusten“ zu begegnen. Sie können dafür sorgen, dass „seelische Einbrüche und gescheiterte Beziehungen nicht unser ganzes Gefühlsleben bestimmen“. In diesem Sinne: Freundschaft!