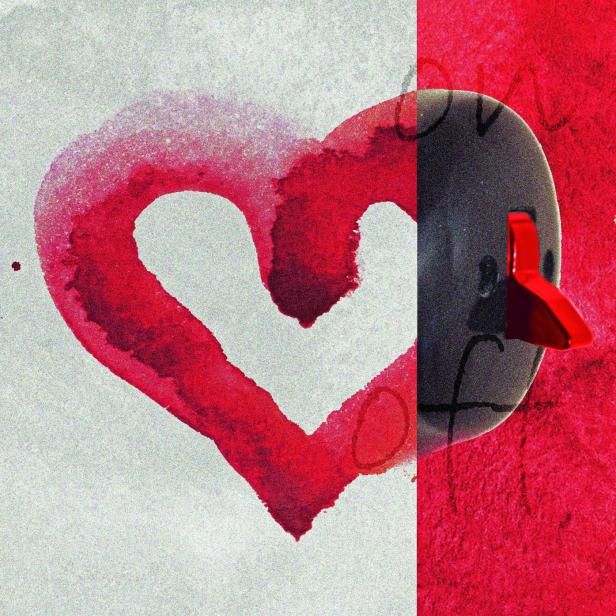Tabuthema Lieblingskind: „Mama, wen magst du lieber?“
Früher waren die familiären Fronten klarer geregelt. Bei Kaiserin Maria Theresia zum Beispiel. Da wusste fast jeder, Tochter Maria Christina ist Mamas Liebling. Gleicher Vorname, gleicher Geburtstag, schlüssige Sache. Im Haushalt von Sisi und Franz herrschten ähnliche Zustände, Marie Valerie die Gewinnerin der mütterlichen Gunst.
Und heute? Kaum vorstellbar das eigene Lieblingskind derart brachial öffentlich zu machen. Na gut, bei der Queen wurde zu Lebzeiten immer spekuliert, wen sie von ihrem Nachwuchs am liebsten haben könnte. Und Kim Kardashian, quasi das amerikanische Pedante zur britischen Monarchin, sagte in ihrer Reality-Show über ihren Sohn: „Saint ist einer meiner Lieblingsmenschen.“ Ihr, mittlerweile Ex-Mann, Kanye West reagierte darauf mit: „Ich denke nicht, dass es gut ist, wenn Eltern Lieblingskinder haben.“ „Es ist die Realität. Ich war für ein gutes Jahrzehnt das Lieblingskind meiner Mutter und jetzt ist es Kylie”, antwortet Kim.
Es ist die Realität. Ich war für ein gutes Jahrzehnt das Lieblingskind meiner Mutter und jetzt ist es Kylie.
Kann man Liebe messen?
Harald Werneck von der Fakultät für Psychologie an der Universität Wien sieht die Sache mit den Lieblingskindern etwas differenzierter. Vorangestellt: belastbare empirische Evidenz oder exakte Zahlen zum Thema „Lieblingskind“ gebe es nicht. „Das fängt schon bei der Definition an: Was heißt denn genau ‚Lieblingskind‘? Dass man ein Kind lieber hat als ein anderes beziehungsweise alle anderen? Wer beurteilt das – der Elternteil oder das Kind? Und welches Kind?“, sagt Werneck. „Aus der Familienforschung wissen wir, dass subjektive Einschätzungen, Wahrnehmungen und Erlebensweisen oft sehr unterschiedlich sein können.“
Dazu kommt, dass selbstgemachte Erfahrungen in der Beziehung zu den eigenen Kindern natürlich eine große Rolle spielen. „Was mit ziemlicher Sicherheit häufig vorkommt, ist, dass sich Eltern dem einen Kind näher fühlen als einem anderen - beziehungsweise glauben, es besser verstehen zu können, sich ihm ähnlicher fühlen, ob im Verhalten oder Erleben“, sagt Werneck. War man selbst die älteste Tochter? Der jüngste Sohn? Jemand, der ähnlich schlecht im Turnunterricht gewesen ist? Oder ein Nachtlicht zum Einschlafen gebraucht hat? „Jede Beziehung ist einzigartig und über die Zeit in aller Regel auch immer wieder Änderungen unterworfen. Insofern ist es wohl eine Illusion, alle Kinder immer gleich zu behandeln, auch wenn man das als Elternteil vielleicht glaubt oder sich vornimmt“, sagt Werneck.
Was heißt denn genau ‚Lieblingskind‘? Dass man ein Kind lieber hat als ein anderes beziehungsweise alle anderen? Wer beurteilt das – der Elternteil oder das Kind? Und welches Kind?
Wann ist „unfair“ ungesund?
Man kann gar nicht alle Kinder immer und überall gleich behandeln. Das wäre laut Werneck auch überhaupt nicht so sinnvoll: „Was man versuchen kann und sollte, ist, in fairer Weise den vielleicht gerade sehr unterschiedlichen Bedürfnissen jedes einzelnen Kindes möglichst gerecht zu werden. Und jedem Kind Liebe und Geborgenheit zu vermitteln und das anzubieten, was das es für eine gesunde Entwicklung gerade benötigt – sei es kuscheln, trösten oder einfach seine Ruhe.“Dabei müsse man natürlich darauf achten, dass sich kein Kind systematisch benachteiligt oder weniger geliebt fühle.
Und diese Konstellationen gibt es natürlich auch. Ein Kind bekommt mehr Geschenke, darf länger aufbleiben, muss weniger im Haushalt mithelfen. Das kann Folgen haben. Benachteiligte Kinder sind oft weniger selbstbewusst, neigen zu Aggressionen und Depressionen. Manchmal äußert sich die Bevorzugung des Geschwisterteils über Umwege, etwa durch Verhaltensstörungen oder Schulprobleme. Werneck sagt, ein offenes Kommunikationsklima und gute Gespräche würden helfen, das frühzeitig zu erkennen.
Wenn Sie das nächste Mal also hören „Mama, Papa, wen mögt ihr lieber?“ erschrecken Sie nicht – wenn Ihr Kind die Ausgangsfrage derart schwammig formuliert, dann dürfen Sie bei der Antwort auch etwas unkonkret werden. Ein Auge auf die Beziehung zu den einzelnen Kindern zu haben, schadet aber jedenfalls nicht. Oder Sie machen es wie die österreichischen Monarchinnen, auf eigene Gefahr versteht sich.