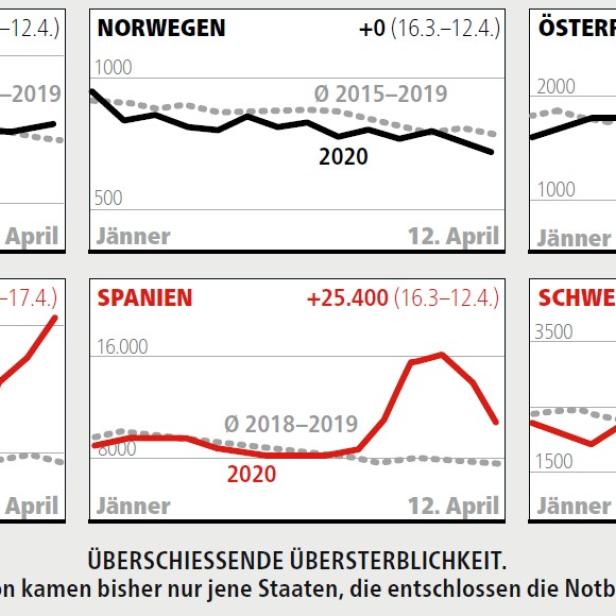Ilse Aichinger: "Ich halte meine Existenz für völlig unnötig"
profil: Sie haben in einem Interview vor einigen Jahren den Wunsch geäußert, dass Ihre Zukunft nicht mehr allzu lange dauern möge.
Aichinger: Ich halte meine Existenz für völlig unnötig. Egal, wie sie verlaufen ist, egal, was ich an Gutem und Schlechtem erlebt habe – ich habe es schon als Kind als eine absurde Zumutung empfunden, dass man plötzlich vorhanden ist. Da müsste man zumindest gefragt werden, ob man nicht einfach wegbleiben will. Dann wäre ich weggeblieben.
profil: Das wussten Sie schon als Kind?
Aichinger: Ja. Unabhängig von Schicksalen. Meine ganze frühe Kindheit mit meiner Großmutter war gut. Es war nur von Anfang an schwierig, weil ich eine Zwillingsschwester habe. Man wird da nicht als Einzelperson wahrgenommen. Wir haben uns auch so ähnlich gesehen, dass selbst meine Mutter uns nicht auseinander halten konnte. Dabei sind wir grundverschieden, wie Fremde. Von Anfang an waren wir beide sehr schwach, nur sind wir leider nicht gestorben.
profil: Sehnen Sie sich nach dem Tod?
Aichinger: Ja. Tod schon, aber ohne Sterben. Nun schreibt ja zum Beispiel Ingeborg Bachmann von „Todesarten“. Der Titel ist falsch wie das meiste, was sie geschrieben hat. Denn es gibt keine Todesarten, es gibt nur Sterbensarten. Der Tod ist der Tod, ein Zustand, kein Prozess wie das Sterben. Weniger schön, aber korrekt – das Genaue ist meist weniger schön und weniger eingängig – müsste es „Sterbensarten“ heißen. Mein einziger Kummer ist, dass man es nicht erfährt, den Zustand „Tod“. Ich finde es erbitternd, dass ich den Triumph, weg zu sein, dann nicht auskosten kann.
profil: Vollkommen weg sein: Ist das Ihre Vorstellung vom Danach?
Aichinger: Ja. Es könnte sein, dass die Substanz von Leuten, die Persönlichkeiten sind – und das ist sehr selten –, bleibt. Ich bin nicht so überheblich, mich für eine solche Persönlichkeit zu halten, und möchte es auch gar nicht.
profil: Dann kann Ihnen der Tod keine Angst machen.
Aichinger: Nein, aber das Sterben. Meine Mutter war Ärztin, und ich habe sehr oft zugeschaut, wenn Leute acht Tage lang gestorben sind: Sterbensarten. Da habe ich gedacht, dass das unangemessen ist nach einer Existenz, die man gar nicht wollte. Sterben ist ein körperlicher Vorgang. Und der Körper, der ja wie ein Tier reagiert, wehrt sich mit Macht und Verzweiflung.
profil: Haben Sie je an Selbstmord gedacht?
Aichinger: Mir misslingt das ganz bestimmt. Ich bin manuell ungeschickt. Ich kann schon nicht einmal eine Suppe kochen. Wenn man es nicht schafft, wird man in eine geschlossene Anstalt gesteckt. Es geht um Erfolg: ob in den Finanzen, in der Liebe oder beim Sterben. Wenn man es schafft, ist es natürlich toll. Wenn nicht, sagt man: „Nicht einmal das!“
profil: Kann es überhaupt eine Ars Moriendi, eine Kunst des Sterbens, geben?
Aichinger: Ja, so etwas gibt es. Die Geschwister Scholl zum Beispiel, die 1943 als Widerstandskämpfer hingerichtet wurden, waren Lebens- und Sterbenskünstler. Das fällt meistens zusammen. Ich bin weder das eine noch das andere. Aber wenn ich zum Beispiel Flaubert lese, erfahre ich manchmal ein so großes Glück, dass es dann ganz egal ist, ob man lebt, tot oder sonst was ist.
profil: Kafka lesen hingegen ist für Sie so, „als erführe ich meinen Sterbetag“. Was ist so tödlich an Kafka?
Aichinger: Es ist so ernst. Kafka war ein Prophet. Ich konnte ihn nicht lesen. „Das Schloss“ hat mich wahnsinnig traurig gemacht und verdüstert. Weil die Macht, die politische und die der Existenz, der man unterworfen ist, darin so massiv erfasst wird. Ich habe sofort gemerkt, wie genau die Sätze stimmen. Auch bei Joseph Conrad zum Beispiel, der zu meinen Liebsten gehört, ist es so: Jeder Satz stimmt, und kein Satz geht da irgendwo dazwischen.
profil: Haben Schreiben und Tod miteinander zu tun?
Aichinger: Gute Literatur ist mit dem Tod identisch. Das ist ein für mich erstrebtes Ziel, weil gute Literatur mit einer gewissen Art von Adel identisch ist. Und dieser Adel besteht in dem Willen zur Nichtexistenz. Ich nehme an, dass jemand wie Joseph Conrad diesen Willen hatte. Als Seemann, der er ja auch war, muss man das haben.
profil: Haben Sie eine Leidenschaft für die Seefahrt?
Aichinger: Ja, wahnsinnig, von Kindheit an. Ich erinnere mich an eine Überfahrt nach Amerika: Da gab es einen Probealarm. Ich habe mir die Leute angeschaut und gedacht, wenn das Schiff jetzt wirklich unterginge, werden es alle wie die Wiener machen, die im Krieg mit ihren Schmuckkästchen in den Keller gegangen sind, der auch gar nicht geschützt war. Dann kam ein Steward zu mir, der gesehen hat, wie ich etwas zusammenpacke, und sagte: „That’s a nonsense.“ Und da ich das Leben für etwas Ähnliches halte, hat mich dieser souveräne Satz nie verlassen.
profil: Bringt dieses Nonsensgefühl nicht auch Heiterkeit?
Aichinger: Alles Komische hilft mir und macht mich glücklich. Im Kino und überall.
profil: Ein Satz von Ihnen lautet: „Was das Kino heute für mich bedeutet; die Möglichkeit, Tod und Leben darin zu finden.“
Aichinger: Ja, der Ort, wo man noch etwas wahrnimmt. Ich bin entweder sehr glücklich, wenn ich aus dem Kino komme, wenn es ein sehr guter Film war, oder zornig, wenn es ein schlechter war. Dann denke ich sofort, dass auch die Erfindung der Existenz nicht besonders ist. Man hat das Gefühl, da hat sich jemand gelangweilt und etwas Falsches erfunden.
profil: In „Film und Verhängnis“ schreiben Sie, dass der Tod im Kino „eigentlich etwas Anzustrebendes“ ist. Soll der Tod Sie im Kino holen?
Aichinger: Nicht im Bellaria-Kino. Das ist mir zu unbequem. Aber sonst würde ich sagen, das wäre nicht schlecht. Ich gehe bis zu viermal am Tag ins Kino, um meine Zeit totzuschlagen, weil es mir schon viel zu lange dauert.
profil: Welcher Film wäre ein idealer Lebensschlussfilm?
Aichinger: Vielleicht lieber ein sehr schlechter. Wenn es ein guter ist, denke ich mir sonst noch, ich würde ihn mir übermorgen noch einmal anschauen wollen. Als Kind habe ich einmal einen Film gesehen, der hieß „FB1 antwortet nicht“. Das war ein schlechter Vor-Ufa-Film mit militanten Raumfahrern, aber der Satz „FB1 antwortet nicht“ war meine Vorstellung von der Existenz. Man antwortet schon einfach nicht. Das hat mich immer begleitet.
profil: Können Sie dem Klischee, dass die Wiener ein besonderes Verhältnis zum Tod haben, etwas abgewinnen?
Aichinger: Die Wiener haben keine Ahnung vom Tod, und sie wollen keine Ahnung vom Tod haben. Keine Linie fährt in Wien so oft wie die Linie 71, und die fährt zum Zentralfriedhof. Mein Großvater, der als Einziger aus der Familie noch im Bett gestorben ist, liegt dort.
profil: Ich kenne jemanden in Wien, der schon vor Jahren auf seinem Grabstein seinen Namen und sein Geburtsjahr hat einmeißeln lassen. Es fehlt nur das Sterbedatum.
Aichinger: Das ist rührend, und es erschüttert mich, weil es zeigt, dass man sich da den Tod als eine neue Heimat, als eine friedvolle Siedlung vorstellt. Dahinter steht auch die Idee, dass der Tod kein Wegsein ist, nur eine leicht veränderte Daseinsform.
profil: Haben Sie denn je darüber nachgedacht, Vorkehrungen für Ihr Begräbnis zu treffen?
Aichinger: Nein. Das Einzige ist: Ich habe große Angst davor, lebendig begraben zu sein. Das ist eine grauenhafte Vorstellung.
profil: Glauben Sie, dass Sie ruhig sterben können?
Aichinger: Ich bin nicht überzeugt davon. Man stirbt schwerer, wenn man spät stirbt. Ich habe das Gefühl, dass mit jedem Tag, den man älter wird, die körperliche und geistige Kraft, Dinge zu akzeptieren, abnimmt. Sie kann nicht zunehmen. Ich habe Bekannte, die melden sich schon jetzt an fürs Altersheim. Schon das Wort Heim ist so entsetzlich. Aber wie macht man das, dass man nicht in ein Heim kommt, wenn man zum Beispiel nicht mehr bei sich ist?
profil: Was halten Sie von der Hospiz-Bewegung?
Aichinger: Das klappt natürlich alles nicht. So viele gibt es gar nicht, die die Kraft und Geduld haben dabeizustehen, wenn jemand stirbt. Die Hospiz-Bewegung ist eine Illusion. Es gibt kein schönes Sterben, es gibt nur ein leichtes Sterben. Wenn man Glück hat, trifft einen der Schlag.
profil: Kann man nicht jeden Versuch verstehen, der danach strebt, den Gedanken ans Sterben leichter zu machen?
Aichinger: Ja, das verstehe ich auch. Es ist sehr wichtig, dass jemand bei einem ist, wenn man stirbt. Aber nicht jemand Beamteter.
profil: Das sagen Sie, obwohl Sie überzeugt sind, dass jeder seinen eigenen Tod und allein stirbt?
Aichinger: Eben weil das Sterben eine so irrsinnige Verlassenheit von Gott und allem ist. Wenn man über Sterbende in den Lagern oder an der Front liest: Alle haben nach ihrer Mutter oder ihrer Frau gerufen. Alle. Da konnten sie noch so mutig sein. Es gibt keinen, der dann nicht doch ruft.
profil: Die Geschwister Scholl und ihre Familie waren sehr religiös. Hilft der Glaube im Umgang mit dem Sterben?
Aichinger: Manchen vielleicht. Ich möchte mir nur nicht falsch helfen lassen. Alle wollen um jeden Preis existieren, existiert haben und weiter existieren. Der Tod ist da ein Misserfolg.
profil: Hat die Misserfolgsstory des Todes damit zu tun, dass wir ihn auslagern in Heime und Krankenhäuser und weiter von uns weghalten, als das früher der Fall war?
Aichinger: Das Sterben war früher auch nicht besser, die Auffassung vom Sterben war anders. Es war kein Misserfolg. Es war eine Art Heimkehr.