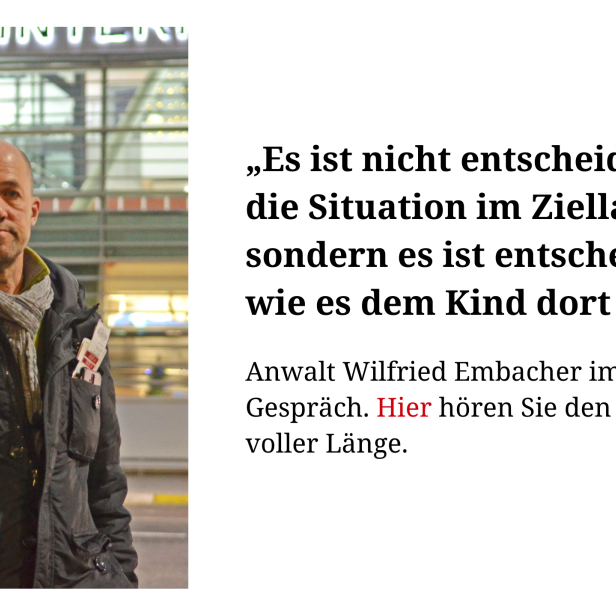Einmal Heimat und zurück: Tina ist wieder in Österreich
Es dämmert schon, als am Nachmittag des 26. Dezember in Wien-Schwechat eine Maschine der Georgian Airways Richtung Tiflis abhebt. Sie ist voll besetzt. Zwischen Dutzenden Georgiern, die mit großen Koffern und Säcken voller Geschenke über die Feiertage ihre alte Heimat besuchen, sitzt der Wiener Rechtsanwalt Wilfried Embacher. Er ist leicht angespannt, was den Erfolg seiner Reise betrifft. Beim Rückflug vier Tage später wird die 13-jährige Tina an seiner Seite sein.
Der Fremden- und Asylrechts-Jurist reist in das Land, in das die Schülerin Tina – mit ihrer Schwester Lea, die damals fünf Jahre alt war, und ihrer Mutter – abgeschoben wurde. Sie packten damals nur das Nötigste ein. Die kleine Lea musste ihre Spielsachen in der Wohnung in Wien-Simmering zurücklassen. Die Abschiebung war von heftigen Protesten begleitet und wurde zu einer Belastungsprobe für die türkis-grüne Koalition. Das Foto von Tina im Polizeibus brannte sich ins kollektive Gedächtnis ein.
Seither ist ein Jahr vergangen. Anwalt Embacher will sich vor Ort ein Bild verschaffen, wie es den abgeschobenen Kindern geht. Und er will Tina zurück in das Land bringen, in dem sie den Großteil ihres Lebens verbrachte und der Alltag ihrer Freundinnen ohne sie weiterging.
Die Geschichte der jungen Georgierin steht für sich. Sie steht aber auch ein Drama, das sich ständig wiederholt. Nur die Orte und Namen wechseln. 2020 wurden 116 Kinder außer Landes gebracht (siehe Grafik). Manchmal berichten Medien darüber, öfter jedoch werden junge Menschen von einem Tag auf den anderen aus ihren gewohnten Bahnen gerissen, ohne dass die Öffentlichkeit davon erfährt. Freunde und Freundinnen weinen. Lehrer und Lehrerinnen sind fassungslos. Junge Menschen finden sich ein paar Flugstunden später in einem Land wieder, das laut offiziellen Papieren ihre Heimat ist, in dem sie sich aber allein, fremd und verloren fühlen.
So wie Tina, um die es in der Geschichte vor allem gehen wird. So wie Ana, 14, und Mariam, 10, die am Rande auch vorkommen. Die beiden Mädchen saßen wenige Wochen vor Tina im Flieger nach Georgien. Die Worte eines Polizisten brennen immer noch wie Salz in einer offenen Wunde, als profil die Geschwister – gemeinsam mit Tina – in Tiflis trifft. „Das Spiel ist aus“, soll der Beamte nach der Festnahme der Familie im November 2020 gesagt haben. Und dabei soll er gelächelt haben.
Embacher wird Tina nach Österreich zurückbringen, wo sie zunächst 90 Tage bleiben kann. Hier wird er für sie ein Schülervisum beantragen. Geht alles gut, darf die Jugendliche das Gymnasium Stubenbastei in Wien fertigmachen. Seit Wochen trägt er alle dafür nötigen Unterlagen und Beglaubigungen zusammen. Embacher ist „vorsichtig optimistisch“ gestimmt. Und doch: An diesem 26. Dezember an Bord der Direktmaschine nach Tiflis ist alles offen. Pläne werden gemacht. Sie können schiefgehen. Träume werden gewagt. Sie können wahr werden. Oder platzen. profil begleitete den Anwalt.
27. Dezember, Tiflis. „Hoffentlich ist er negativ.“ Tina und ihre Mutter sind zum PCR-Test unterwegs, einem von mehreren, den das Mädchen für die Einreise nach Österreich machen muss. Als Tina am 28. Jänner 2021 mit Lea und ihrer Mutter in der Abschiebemaschine saß – in der Reihe dahinter zwei Polizisten zur Bewachung –, hatte ihre Schule in Wien auf Distance Learning umgestellt. Nach den Semesterferien ging der Unterricht online weiter. Tina loggte sich aus fast 3000 Kilometer Entfernung ein. Im Herbst stieg ihre Klasse in die Vierte auf. Das Mädchen versuchte, mit dem Lernstoff mitzuhalten. Ihr altes Gymnasium war inzwischen in den Präsenzmodus zurückgekehrt. Ohne Online-Kontakt zu ihren Lehrern und zur Klasse fiel das Mädchen zurück. In Georgien hatte Tina diverse Einstufungstests und Prüfungen absolviert, aber nie ganz in den schulischen Alltag hineingefunden. Die georgische Schrift blieb eine große Hürde.
Das erzählt Tina während einer Autofahrt in Tiflis. Vom Corona-Test im Spital geht es zurück in den Wohnblock am Stadtrand. Die Sitten im Verkehr sind rau. Man sieht Autos, denen wesentliche Teile der Karosserie fehlen. Nach ihrer Abschiebung lebte Tina bei ihrer Oma in Tianeti, einem Bergdorf, 70 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Im Herbst zog sie mit ihrer Mutter Nino und ihrer Schwester Lea in die Hauptstadt. Ihre Wohnung liegt im achten Stock. Hinter der Eingangstür wartet ein junger Pekinese, den Tina zu ihrem 13. Geburtstag im August geschenkt bekam. Sie nennt ihn „Buddy“, weil er sie tröstet und beruhigt, wenn es ihr schlecht geht. Kaum geht die Tür einen Spalt auf, springt ihr der Hund auch schon entgegen. Die Miete beträgt rund 200 Euro im Monat.
Ohne die Überweisungen der Großmutter väterlicherseits, die als 24-Stunden-Betreuerin in Griechenland arbeitet, „könnten wir uns das niemals leisten“, sagt Tinas Mutter. Ihre eigene Mutter verdiente als Volksschullehrerin mit 30 Jahren Berufserfahrung gerade einmal 160 Euro. Nun ist sie in Pension und muss mit noch weniger auskommen. Ohne Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten könnte sie – wie so viele im Land – nicht überleben. Die Gehälter sind niedrig, die Lebensmittelpreise hoch. Später, beim Rundgang durch ihr Wohnviertel, wird Tina in einem Supermarkt – „nur zum Beispiel“ – auf eine Packung Pringles zeigen, für die man in Tiflis so viel bezahlt wie in Wien.
Überhaupt, Wien! Tina will „all die Orte wiedersehen, wo ich mit meinen Freunden war, den Stephansplatz, den Stadtpark, die Schule“. Ihr Ticket für den Rückflug am 30. Dezember ist gebucht. Es wartet in einer Mappe. Silvester wird Tina nicht mehr in dem Land sein, in dem es für sie „nichts zu tun gibt, außer Aufstehen, Lea in den Kindergarten begleiten, mit dem Hund spazieren gehen, mit der Mutter reden“, oder oft auch nur: „Einfach nur dasitzen.“ „Ich vermisse meine Freunde so sehr, das ist nicht mehr normal“, sagt Tina.
28. Dezember, Tiflis. Es ist ein sonniger Wintertag. Die Gebirgskette großer Kaukasus ist gut zu sehen. Ana, 14, und Mariam, 10, warten mit ihrer Mutter vor dem Hotel. Hier treffen sie auf Tina und ihre Mutter. Die Familien begegnen einander zum ersten Mal. Fast hätten sie sich schon vor mehr als einem Jahr im Flieger kennengelernt. Ana, Mariam und ihre Mutter wurden im November 2020 aus Wien abgeschoben. Auch bei Tinas Familie klopfte damals die Fremdenpolizei an die Wohnungstür, traf aber die Mutter nicht an. Die Abschiebung wurde ausgesetzt. Am 2. November schlug ein islamistischer Terrorist in der Wiener Innenstadt zu. Die Polizei hatte danach andere Sorgen. Erst drei Monate später wurden Tina und ihre Familie nach Georgien abgeschoben. In der Hauptstadt steht nun ein gemeinsamer Stadtrundgang auf dem Programm.
Das vergangene Jahr setzte der Familie sehr zu. Die Mutter von Ana und Mariam kam in Abchasien zur Welt, flüchtete, als dort der Krieg ausbrach, nach Tiflis, kämpfte sich hier durch, arbeitete, machte einen Bachelor in Wirtschaft, heiratete. Schicksalsschläge warfen sie immer wieder zurück. Als das Hotel einstürzte, in dem Vertriebene untergebracht waren, packte die Familie ihre Sachen und ging 2009 nach Österreich, „um etwas Gutes für die Kinder zu machen“. Ana war damals zwei, Mariam noch nicht geboren. „Meine Kinder fragen mich jeden Tag, wann sie zurückdürfen“, sagt die Mutter. Was soll sie ihnen sagen? Ihr Vater ist noch in Wien, hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser und schickt Geld. Anas frühere Mittelschule sammelte Spenden, damit die Mädchen in Tiflis das private deutsche Gymnasium besuchen können.
Ohne Hilfe von außen wäre das unmöglich. Ana ist von auffallender sprachlicher Gewandtheit. Ihr präziser Ausdruck, der reiche Wortschatz beeindruckte auch ihre Lehrer in Wien. Schulleiter Werner Schuster findet, Ana habe sich gar nie integrieren müssen, schließlich ist sie in Österreich aufgewachsen und sozialisiert: „Man muss gar kein Herz haben, um solche Kinder im Land zu lassen, Hirn genügt“, sagt er. Seine ehemalige Schülerin wird im Lauf des Tages mehrfach betonen, wie „unendlich dankbar“ sie sei, die deutsche Schule besuchen zu können.
Das ändert jedoch nichts daran, dass die 14-Jährige sozial in der Luft wurzelt. Die Erkundung der Stadt macht ihr Freude. Sie hakt nach, interessiert sich für Details. In unbeobachteten Momenten aber bohrt sich ihr Blick in den Boden, als läge irgendwo darunter die Antwort auf ein schmerzendes „Warum?“ Wie geht es ihr mit der Nachricht, dass Tina bald in Österreich sein wird, während sie und ihre Schwester bis auf Weiteres in Georgien bleiben? Wie im Chor antworten die Schwestern, dass sie „superfroh für Tina“ sind, sie wüssten schließlich, „wie schwierig es ist, wenn man aus allem, was man sich aufgebaut hat, plötzlich herausgerissen wird“.
Die zehnjährige Mariam will Tierärztin werden und würde am liebsten alle Hunde einsammeln und retten, die in Tiflis durch die Gegend streunen. Ana wollte einmal Schauspielerin werden. In einer Folge der Kriminalserie „SOKO Donau“ spielte sie ein Mädchen, das knapp der Abschiebung entging. Im richtigen Leben war das nicht gelungen. Nach ihrer Rückkehr nach Georgien ging es ihr so schlecht, dass ihre Mutter sie zu einer Psychologin brachte. Nun will die 14-Jährige lieber Kinder- und Jugendpsychologin werden. Um später jungen Menschen wie ihr selbst zu helfen? Ana schluckt: „Ja, genau.“
Wenn die Schwestern abends mit ihrem Vater telefonieren, werden sie ihm erzählen, „dass wir Tiflis auf eine neue Art erkundet haben“. Der Weg führt vorbei an hippen Restaurants, neuen Hotels und restaurierten Häusern im Art-déco-Stil. Stadtführer Giorgi Chachua spricht perfekt Deutsch. Er hat einige Jahre in Deutschland gelebt und kam – als einer von wenigen Auswanderern – wieder zurück, um eine Familie zu gründen und etwas aufzubauen.
Nun zeigt er den abgeschobenen Mädchen und ihren Müttern den Mtatsminda, wörtlich „heiliger Berg“, wo im 6. Jahrhundert vor Christus ein Mönch Einkehr hielt und heute ein Fernsehturm steht, deutet auf eine Moschee in der Ferne, in der Sunniten und Schiiten gemeinsam beten, führt sie mit der Gondel-Seilbahn auf die Festung Narikala hinauf. An die 40 Mal war Tiflis – auf Georgisch Tbilissi, der Name leitet sich von den schwefelhältigen, bis zu 47 Grad heißen Quellen ab, die im Bäderviertel aus der Erde sprudeln – im Lauf der Geschichte zerstört und neu aufgebaut worden. Die Spuren früherer Eroberer, von den Mongolen über die Araber und Türken bis zu den Russen, überdauerten in Architektur, Kunst, Musik – und im Essen.
In einer alten Kirche kaufen alle Kerzen und zünden sie an. Wieder draußen erkundigt sich Mariam, ob sie verraten dürfe, worum sie Gott gebeten habe. Aus Sicht ihrer Mutter spricht nichts dagegen. „Dass ich wieder nach Österreich komme. Dafür würde ich alles tun“, erklärt die Zehnjährige. Am Abend werde sie das auch ihrem Vater berichten, er wiederum werde schildern „was in Wien läuft und dass er uns vermisst“. „Das ist eigentlich das, was wir uns am öftesten sagen“, ergänzt die ältere Schwester: „Wir durften uns ja nicht einmal richtig verabschieden.“
Wie bitte? Die Bemerkung fällt eher beiläufig auf der Tour durch die Stadt – und zielt geradewegs ins Zentrum der politischen Debatte über Kinderabschiebungen, die sich am „Fall Tina“ vor einem Jahr entzündete.
Die Bilder von maskierten WEGA-Beamten und Polizeihunden verstörten damals die Öffentlichkeit. Eine Kindeswohlkommission unter Leitung von Irmgard Griss wurde ins Leben gerufen, die vergangenen Sommer Bericht legte. Kinder sollten „möglichst geringen Schaden“ nehmen, fasst Elisabeth Schaffelhofer-Garcia Marquez vom Netzwerk Kinderrechte die darin enthaltenen Empfehlungen zusammen: „Das heißt: nicht während laufender Schule abschieben, nicht in der Nacht, ohne Polizei-Spezialeinheiten und ohne großes Tamtam. Außerdem müssen sich Kinder von ihren Freundinnen, der Schule, ihrem bisherigen Leben verabschieden können, um aus all dem gut rauszukommen.“ Bisher hat sich an der Praxis wenig geändert. Zwar wurden Richterinnen und Richter am Bundesverwaltungsgericht geschult, nicht jedoch das Personal im Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA). Die erste Instanz im Asylverfahren untersteht dem Innenministerium, „und hier tut man so, als wäre für Kinderrechte nur das Justizministerium zuständig“ (Schaffelhofer).
Das „Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern“ schrieb vor mehr als zehn Jahren fest, dass bei allen Maßnahmen, die Heranwachsende betreffen, das Kindeswohl vorrangig erwogen werden muss. So steht es in Artikel 1. Um das zu gewährleisten, sind die Betroffenen anzuhören. Selbst bei großzügiger Auslegung ist das, was Kinder und Jugendliche in der Praxis erleben, wenn sie außer Landes gebracht werden, damit schwer zu vereinbaren.
Im Fall von Ana und Mariam reichen die Versuche, die Familie abzuschieben, einige Jahre zurück. Immer wieder wurde dabei das Kindeswohl missachtet, wie ein profil vorliegender Bericht aus dem Frühjahr 2019 zeigt. Um der Eltern habhaft zu werden, hatte die Polizei vor der Schule der Töchter „Vorpass gehalten“. Auf dem Nachhauseweg gingen die Beamten der damals achtjährigen Mariam nach, in der Hoffnung, dass sie ihnen den Weg zu ihren Eltern weist. Sie aber traf die älteste Schwester. Beide wurden festgenommen, die volljährige Schwester allein abgeschoben, Mariam landete im Krisenzentrum. Die Kinderrechtsexpertin Schaffelhofer hält das für untragbar: „Dass sich die Polizei gewisser Methoden bedient, um jener habhaft zu werden, die untertauchen, ist nachvollziehbar. Aber, stopp! Auch wenn es der einfachste Weg ist, über die Kinder an die Eltern heranzukommen, ist es nicht erlaubt. Und man darf ihnen auch nicht umhängen, dass sie schuld sind, dass die Familie außer Landes gebracht wird.“
Im November 2020 bestellte das BFA Ana, Mariam und ihre Mutter zu sich. Als ihr Rechtsberater nachfragte, ob die Familie festgenommen wird, wiegelte man ab. Die Auskunft erwies sich als List. Tatsächlich landete die Familie in Schubhaft.
Über ein Jahr später, bei einer Rast am Fuße der Kartlis Deda, der monumentalen Figur der „Mutter Georgiens“, erzählt Ana, sie habe eine Panikattacke bekommen, doch habe sich damals „niemand für mich interessiert“. Die Beamten hätten ihr bloß nahegelegt, sich „nicht so anzustellen“ und ihrer Mutter aufgetragen, „dafür zu sorgen, dass ich mich beruhige“. Es tut ihr heute noch weh.
29. Dezember, Tianeti. Tina nützt den letzten Tag vor der Abreise, um für ihre Freundinnen Schminksachen und bunte Socken mit georgischen Motiven zu kaufen. Ihre Mutter Nino nimmt profil in das Dorf ihrer Kindheit mit.
Die Reise führt nach Tianeti, 70 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, und in mehrfacher Hinsicht in die Vergangenheit. Es gab Jahre, in denen der Strom nur zu Silvester aufgedreht wurde, und am 2. Jänner wieder weg war. Nino und ihr Bruder schliefen mit den Eltern in einem Raum. Es war der einzige, in dem ein Ofen stand. Geheizt wurde mit Holz. Nino setzt sich an den Schreibtisch, an dem sie sich als junges Mädchen beeilen musste, ihre Schulaufgaben zu erledigen, solange es hell war. Danach gab es nur mehr Kerzenlicht. Ninos Mutter – Tinas Großmutter – unterrichtete in der Volksschule, der Großvater arbeitete in Griechenland am Bau. Mit dem Geld, das er nach Hause schickte, wurde ein Haus gebaut, und seine Kinder bekamen eine Ausbildung.
Vor zwei Jahren starb er an Lungenkrebs. Er war 59. Viel Zeit war ihm nicht geblieben, das Haus zu genießen, für das er sich als Gastarbeiter abgerackert hatte. „Das ist Menos Garten“ steht auf Georgisch auf einem Schild. Ninos Mutter hängte es zu Ehren des Verstorbenen in der Weinlaube auf. Eine schwarze Katze streift herum. Sie wurde für Tina angeschafft. Auf der Veranda döst ein Hund. Außenstehenden bietet sich eine Idylle. Für Nino ist alles von bleierner Schwere: „Meine Kindheit ist schwer zu erzählen“ sagt sie.
Männer schafften an, ließen sich bedienen, betranken sich. Wenn ihnen danach war, schlugen sie ihre Frauen, ohne dafür belangt zu werden. Mädchen mussten fürchten, entführt und jung verheiratet zu werden. Als Nino den in viele Sprachen übersetzten Roman „Das achte Leben“ von Nino Haratischwili las, erkannte sie Teile ihrer Geschichte wieder. Rückblickend frage sie sich: „Wie haben wir das überlebt?“ Als sie 13 war, so alt wie Tina heute, hätten im Dorf drei Häuser gebrannt. Ein Bursche hätte einen anderen mit dem Messer erstochen. Die Brände seien aus Rache gelegt worden.
Es ist alles noch da: das Schlafzimmer, die Kommode, der Ofen, der Schreibtisch. Und das Patriarchat. Als Tina nach der Abschiebung aus Österreich neun Monate im Haus ihrer Oma lebte, gab es Tage, an denen sie niemanden sehen wollte. „Wozu?“, habe sie erwidert, als ihre Mutter sie bat, aus dem Zimmer zu kommen: „Mir hört ohnehin niemand zu. Ich werde hier nicht akzeptiert.“ Eine Zwölfjährige habe im Dorf den Mund zu halten, sich die Haare nicht rot zu färben, die Nägel nicht zu lackieren.
Auf dem Piano, auf dem ihre Mutter Nino als Jugendliche spielen lernte, steht das Foto einer jungen Frau. Das ist der wundeste Punkt ihrer Geschichte. Ihr Bruder habe bei der Polizei Karriere gemacht und die Frau auf dem Bild kennengelernt. Sie stammte aus Tianeti, war in die Stadt gezogen, hatte Journalismus studiert und im Justizministerium gearbeitet. Die beiden bekamen einen Sohn. Ihr Bruder sei rasend eifersüchtig gewesen. Im Mai 2014 habe er seine damals 24-jährige Frau erschossen. Der Fall sei durch die Medien gegangen. TV-Stationen hätten berichtet. Die Familie des Opfers habe „am Grab geschworen, blutig Rache zu nehmen“. Gemeinsame Bekannte hätten sie, die Schwester, gewarnt. Polizeikollegen ihres Bruders hätten erklärt, sie nicht schützen zu können. Ihr Bruder kam ins Gefängnis und bleibt dort noch für Jahre.
Im August 2014 packte Nino ihre Sachen und flog mit ihrer Tochter nach Österreich zurück. Sie war acht Jahre zuvor als Au-pair-Kraft in das Land gekommen und dann geblieben, wie viele ihrer Landsleute. Sie suchte um Asyl an, schlug sich irgendwie durch, brachte es aber nicht zu einem regulären Aufenthaltstitel. 2012 gab sie auf und ging nach Georgien zurück. Tina war damals vier. Die Familie habe nicht vorgehabt, ein weiteres Mal auszuwandern, sagt Nino. Doch zwei Jahre später sei „die Sache mit meinem Bruder“ passiert.
Tinas Mutter packte erneut ihre Sachen und landete im Herbst 2014 mit ihrer Tochter im Flüchtlingslager Traiskirchen. Drei Monate später verlegte man sie in eine Unterkunft am Semmering. Nach dem Winter kam sie für eine Weile bei der Flüchtlingshelferin Ute Bock unter und suchte danach eine Wohnung. In Wien-Simmering wurde sie fündig. Der Verein Ute Bock streckte die Kaution vor, die sie in 60-Euro-Raten abstotterte. Es habe sie immer geärgert, dass sie nicht arbeiten durfte, sagt Nino. Sie machte eine Sozialausbildung, sie sprach Russisch, Georgisch, Englisch, Deutsch, also übersetzte sie für Flüchtlinge und arbeitete als ehrenamtliche Familienhelferin.
Tina ging im Bezirk in die Volksschule, ihre 2015 geborene Schwester Lea besuchte den Kindergarten. Als ihre Ältere zehn war, meldete Nino sie im Gymnasium Stubenbastei an, weil man hier Russisch unterrichtet. Über den Vater ihrer Kinder sagt Nino nicht viel. Nur: „Die Kinder haben ihn lieb. Er ist ihr Vater.“ Laut vorliegenden Informationen sitzt er derzeit in Wien in U-Haft. Er steht im Verdacht, Mitglied einer kriminellen Organisation zu sein, die Diebstähle begehen und mit Aufenthaltstiteln handeln soll. Seine genaue Rolle ist ungeklärt.
Am 25. Jänner 2021 klopfte es an die Tür ihrer Wohnung in Wien-Simmering. Nino und ihre Töchter saßen beim Abendessen. Es gab Spaghetti. Die Mutter packte das Nötigste ein. Die Polizei brachte die Familie in die Schubhaft-Unterkunft in der Wiener Zinnergasse.
Theo Haas, 18, ist Schulsprecher am GRG 1 Stubenbastei. Die Schule befand sich im Distance-Learning-Modus, als die Nachricht an sein Ohr drang, dass ein Mädchen aus der dritten Klasse abgeschoben wird.
Mit Fridays for Future hatte man an seinem Gymnasium Erfahrung, Asyl war bisher kein Thema gewesen. Haas trommelte eine Runde zusammen. Man begann zu telefonieren, kontaktierte Medien und Politiker, startete eine Online-Petition. Vor dem Gebäude, in dem Tina und ihre Familie auf die Abschiebung warteten, schrieben Jugendliche mit Seilen „Tina“ auf den Boden. Das Mädchen winkte aus einem vergitterten Fenster herunter. Immer mehr Menschen schlossen sich dem Protest an.
Nach Tinas Verschwinden bauten Lehrkräfte das Thema Kinderabschiebungen in den Unterricht ein. Im Kreis der engsten Freunde von Tina klaffte eine Lücke. Für alle anderen kehrte wieder der Alltag ein. Vergangene Woche bekam Haas den Link zur profil-Reportage „Tina ist zurück“ zugeschickt. Der Schulsprecher freute sich, dass die Geschichte der 13-Jährige eine gute Wendung nahm. Bereits im nächsten Augenblick fiel ihm die 18-jährige Ajla ein, die in der Anton-Krieger-Gasse in Wien vor der Matura steht und Ende Jänner das Land verlassen soll: „Die Geschichte wiederholt sich. In der Praxis hat sich wenig geändert. Das ist frustrierend“, sagt er.
Seine Kollegin Maria Marichici – sie ist Schulsprecherin der Anton-Krieger-Gasse – sagt im profil-Gespräch: „Ajla ist seit fünf Jahren in Österreich, Wien ist ihr Zuhause. Sie ist die Klassenbeste und will Sozialarbeiterin werden.“ Als vergangenen November der Direktor der Anton-Krieger-Gasse live in der „Zeit im Bild“ zum bevorstehenden Lockdown interviewt wurde, hielten Schülerinnen und Schüler Schilder in die Kamera. „Gerechtigkeit für Ajla“ stand auf einem. Noch haben sie die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sie bleiben darf.
Zurück zu Tina. Im Dorf ihrer Großeltern leben kaum noch Junge. Viele Häuser stehen leer. Wer kann, zieht in die Stadt oder geht ins Ausland. „Es gibt hier keine Familie, in der nicht jemand ausgewandert ist“, sagt ihre Mutter Nino. In der Dorfschule sitzen in den unteren Klassen noch vier, fünf Kinder, in den höheren Schulstufen manchmal nur noch eines. Das Kino, in dem früher Bollywood-Filme liefen, ist schon lange zu. Im Sommer kommen ehemalige Bewohner zurück, um sich in der Bergluft zu erholen. Ninos Onkel wohnt nebenan. Als er seine Nichte vor dem Haus sieht, bittet er sie herein. Im Ofen knistert Holz. Der Fernseher läuft. Seine Tochter, Ninos Cousine, studierte Informatik und macht jetzt eine Ausbildung in Wien. Kommt sie zurück? „Ja“, sagt Ninos Onkel.
Fast alle brechen mit diesem Versprechen auf, nicht alle lösen es ein. Ihr Vater habe sie früh motiviert, Sprachen zu lernen, „damit ich aus Georgien hinauskomme“, erzählt Nino. Sie lernte Russisch und studierte in der Hauptstadt Deutsch. Und sie habe viel gekämpft. Dass man sie in Österreich eine „Rabenmutter“ geschimpft habe, weil sie versucht habe, einen humanitären Aufenthalt zu bekommen, schmerze sie: „Man muss kämpfen für die Kinder“, sagt sie auf der Fahrt vom Dorf ihrer Kindheit zurück in die Hauptstadt. Tinas und Leas Glück sei das Einzige, das für sie zähle.
Tina wird in Österreich bei einer Gastfamilie wohnen, dafür sei sie, die Mutter, so dankbar, dass sie es mit Worten kaum auszudrücken vermöge. Ihre Tochter werde es dort guthaben. Sollte sie sich wider Erwarten nicht wohlfühlen, stehe es ihr frei, zurückzukommen. „Tina“, habe sie nach der gestrigen Stadtführung durch Tiflis zu ihr gesagt: „Wir haben so viele schöne Orte entdeckt. Was sagst du?“ „Mama, das ist nicht das wahre Leben“, habe ihre Tochter geantwortet. Für die 13-Jährige steht fest, dass ihr wahres Leben in Wien wartet.
Ihr Anwalt sieht es ebenso. Am letzten Abend in Georgien resümiert Embacher, die Reise habe ihn bestätigt, „dass Kindeswohlabwägungen völlig unzureichend gemacht werden“. Es genüge eben nicht, bloß festzustellen, „dass es Schulen und eine ausreichende Versorgung gibt und dass es im Land einigermaßen friedlich ist, sondern man muss immer konkret fragen: Wie geht es diesem betroffenen Kind hier?“
30. Dezember, Wien. Es ist stockfinster, als Tina und ihre Mutter Richtung Flughafen aufbrechen. Vor einem Jahr hat ihr Cousin sie nach ihrer Abschiebung aus Österreich von dort abgeholt. Nun chauffiert er sie wieder. Anwalt Embacher behält die rote Mappe, in der Tina Pass, Genesungsbescheid, Ninja-Pass, den jüngsten PCR-Test und das Rückflugticket aufbewahrt, ständig im Auge. Check-in. Passkontrolle. Zwischenstopp in Istanbul. Landung in Wien. Passkontrolle. Alles geht gut. Nun nur noch den schwarzen Koffer vom Gepäcksband hieven. In der Ankunftshalle wartet Tinas beste Freundin. In den nächsten drei Monaten wird sie bei deren Familie leben. Die 13-Jährige will die Zeit nützen, um Versäumtes nachzuholen, mit der U-Bahn zu fahren, Freundinnen zu treffen, all die Orte wiederzusehen, an denen sie glücklich war.
Als profil sie einige Tage später in Wien noch einmal trifft, hat sie bereits einiges davon erledigt. Sie ist mit ihrer besten Freundin in der Stadt unterwegs. Wenn sie die Stimme ihrer Mutter oder ihrer Schwester Lea hören will, spielt sie auf dem Handy ihre jüngsten Videos und Sprachnachrichten ab. Seit einigen Tagen schläft die Kleine in Tiflis in Tinas Bett. Es ist ihre Art, der großen Schwester nahe zu sein. Und in Wien hält Tina ihr Handy an das Ohr der Freundin. „Das ist Lea!“ Die Freundin hört eine Weile zu: „Ich verstehe doch kein Georgisch.“ „Egal“, antwortet Tina: „Hör nur, wie süß.“ An Georgien vermisst sie sonst nicht viel.
Mitarbeit: Thomas Hoisl, Lena Leibetseder