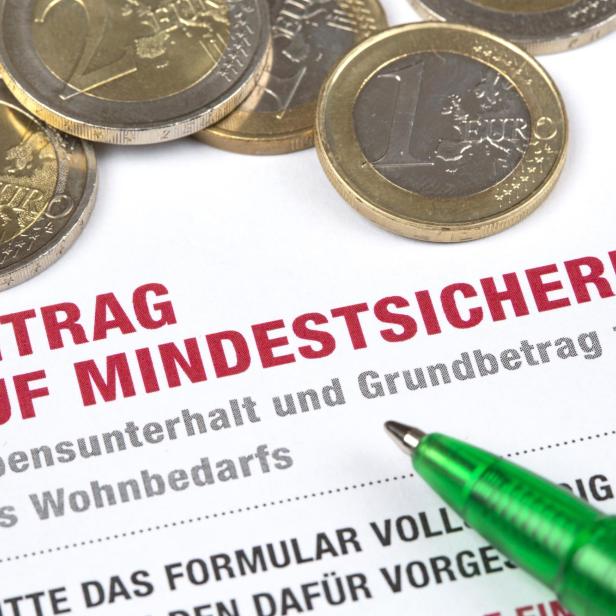Kapitel Budget: Defizit, welches Defizit?
Wer auch immer Österreich regieren wird, muss den Sparstift ansetzen: Der Konsolidierungsbedarf wird alleine für das Jahr 2025 mit über sechs Milliarden Euro beziffert. Bis 2031 sind es sogar 18 Milliarden Euro. Doch die geleakten Verhandlungsprotokolle offenbaren, dass es wenig Ambitionen zu Einsparungen gibt, zu neuen Steuern schon gar nicht. Mit Ausnahme der zwischen den beiden Parteien umstrittenen Bankenabgabe.
Dabei brauchten FPÖ und ÖVP für die Präsentation ihrer ersten Sparpläne Anfang Jänner weniger als eine Woche. Ein paar der Pläne: Der Klimabonus und die Bildungskarenz sollen ersatzlos gestrichen werden und die Ministerien zum Sparen verpflichtet werden. Doch für die Folgejahre sind die Verhandler der Volkspartei und der Freiheitlichen deutlich weniger ambitioniert.
Im Gegenteil: Insbesondere die FPÖ will richtig viel Geld verteilen. Gegenfinanzierung: Völlig offen. Die geleakten Verhandlungsprotokolle geben Aufschluss darüber, bei welchen teuren Projekten sich FPÖ und ÖVP einig geworden sind und bei welchen nicht. Ganze 21 Mal findet sich im Protokoll der Hinweis „budgetrelevant“.
Streichung der ORF-Haushaltsabgabe
Ein Zankapfel in den Verhandlungen: die stufenweise Abschaffung der ORF-Haushaltsabgabe, die je nach Bundesland zwischen 180 und 240 Euro pro Haushalt pro Jahr ausmacht. Ab 2027 soll der ORF aus dem Budget finanziert werden, fordert die FPÖ. Neben der medienpolitischen Problematik stellt sich die Frage, woher die Budgetmittel für den öffentlich-rechtlichen Sender aufgebracht werden sollen. Wenn der ORF, wie von der FPÖ gefordert, 15 Prozent einsparen soll, blieben noch immer rund 600 Millionen Euro, die mit einem Mal aus dem Steuertopf berappt werden müssten.
CO2-Abgabe vor dem Aus
Das Grünen-Leuchtturm-Projekt, die CO2-Bepreisung, ist der FPÖ schon lange ein Dorn im Auge. Die FPÖ will sie abschaffen. Doch damit würde eine weitere Milliarde im Budget fehlen. Den Klimabonus als (vermeintliche) Rückführungsmaßnahme der CO2-Steuer wollen Blau und Schwarz jedenfalls abschaffen.
Ein Grünen-Projekt, welches hingegen beibehalten werden soll, ist der Energiezuschuss für die Industrie. FPÖ und ÖVP wollen beide eine Verlängerung des Strompreiskosten-Ausgleichsgesetzes 2022 bis 2030.
Senkung der Lohnnebenkosten – diesmal wirklich?
Eine Maßnahme, die seit Jahrzehnten zwischen den Sozialpartnern umstritten ist, könnte unter einer blau-schwarzen Regierung tatsächlich umgesetzt werden: eine Senkung der Lohnnebenkosten von fünf Prozentpunkten über sieben Jahre. Ob der Anteil vom Kuchen den Arbeitnehmern oder -gebern genommen wird, wurde bisher noch nicht fertig verhandelt.
Ökonomen sprechen sich zwar seit Jahren für eine „deutliche Senkung der Lohnnebenkosten“ aus, aber: „Wenn man gleichzeitig sagt, es darf nirgendwo eine Steuererhöhung geben, dann wird das Projekt an der Gegenfinanzierung scheitern“, sagt WIFO-Chef Gabriel Felbermayr im profil-Interview.
Der Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) soll laut den blau-schwarzen Plänen künftig direkt aus dem Budget und nicht mehr über die Lohnnebenkosten finanziert werden. Der Ausgleichsfonds finanzierte bisher zweckgebunden die Familienbeihilfe, Schulfreifahrt oder Schulbücher.
Mehr Netto am Konto
Weitere teure Projektideen der Vielleicht-oder-vielleicht-auch-nicht-Koalition: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern soll am Jahresende mehr Geld übrig bleiben. FPÖ und ÖVP versprechen mehr als eine Verdoppelung von Werbungskostenpauschale (132 auf 300 Euro) und Veranlagungsfreibetrag (730 auf 1500 Euro). Auch bei einer jährlichen Erhöhung der Pendlerpauschale, einer Steuerbefreiung auf Überstunden und einer „Glättung“ der Grenzsteuersätze für 30 und 40 Prozent sind sich die Parteien einig.
Wie diese Maßnahmen gegenfinanziert werden, steht nicht im Papier. Wie viel die Maßnahmen eigentlich – wie im Protokoll angeführt – „KOSTEN?“, muss mit Verweis auf das Finanzministerium erst berechnet werden.
Einen Hinweis liefert ein Schlagwort im vierseitigen Kapitel „Finanzen und Steuern“: Das Wort „Verwaltungsvereinfachung“ findet sich darin sieben Mal. Wo konkret die Verwaltung effizienter gestaltet werden sollte, konnten schon die vorangegangenen Regierungen unter ÖVP-Führung nicht beantworten.
Der Direktor des Instituts für Höhere Studien (IHS), Holger Bonin, mahnt zur Achtsamkeit angesichts der angespannten budgetären Situation, denn ohne Gegenfinanzierung werden geplante Ausgaben ein schwieriges Unterfangen – eine Erhöhung von Freibeträgen als Gießkannenmaßnahme sei teuer. „Die Motivation ist wahrscheinlich nicht dahinter, das Budget zu entlasten, sondern Signale zu senden. Stichwort: ‚Leistung muss sich lohnen.‘“
Was Bonin vermisst, sind die tatsächlichen Reformen. Anstelle die 48. Arbeitsstunde zu belohnen, „wäre es sinnvoller, für Teilzeitbeschäftigte einen befristeten Steuervorteil für das Wechseln auf mehr Stunden zu geben“, so der IHS-Chefökonom.
Statt Pensionsreform: Arbeit in der Pension belohnen
Senioren gelten als wahlentscheidende Gruppe, aber auch als stilles Arbeitskräftepotenzial. Auch, weil de facto nur wenige Arbeitnehmer bis zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter arbeiten (können).
Einigkeit gibt es dahingehend, Arbeiten im hohen Alter steuerlich zu entlasten. Das Wie unterscheidet die beiden Parteien. Von Seiten der FPÖ bedeutet das: weniger Lohnnebenkosten. Von Seiten der ÖVP: sozialversicherungsfrei (außer Unfallversicherung) und eine 20-prozentige Pauschalbesteuerung. Pensionisten sollen mehr Geld erhalten, wenn sie weiterarbeiten. IHS-Chef Bonin bezweifelt die Wirksamkeit: „Menschen in der Pension haben eine Präferenz, in Pension zu sein und nicht nebenher zu arbeiten.“
Fest steht: Viele der verhandelten Maßnahmen kosten Geld. Wo diese Millionen angesichts der angespannten Budgetsituation frei gemacht werden sollen, ist abseits der bereits vor Wochen präsentierten Pläne kaum ersichtlich.
Einer der wenigen Sparpläne bleibt mehr als vage: „3,5 – 24,5 Mrd. bei Subventionen einsparen“. Welche Subventionen gemeint sein könnten, bleibt unklar. Ein pikantes Detail: Die Parteien planen offenbar eine „Zentralstelle für Deregulierung und Entbürokratisierung“. Das klingt wohl nicht zufällig nach dem heftig in der Kritik stehenden Department of Government Efficiency (DOGE), das der US-Milliardär Elon Musk leitet.