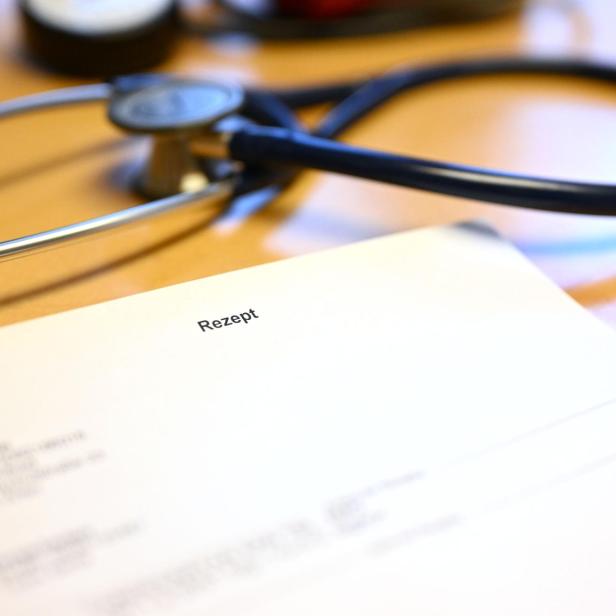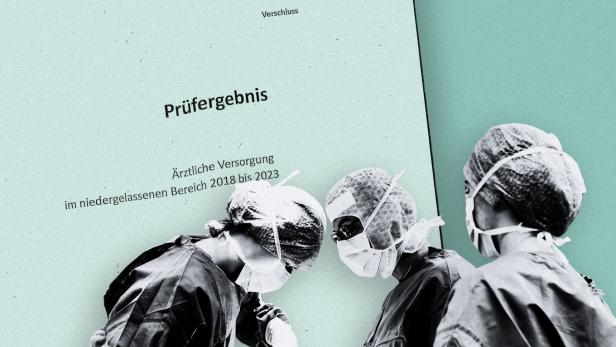
Rechnungshof empfiehlt Entmachtung der Landesärztekammern
Rechnungshof empfiehlt Entmachtung der Landesärztekammern
Im September 2024 begaben sich Prüfer des Rechnungshofes auf eine Spurensuche, die sie knapp ein halbes Jahr beschäftigen sollte: Sie wollten herausfinden, warum Österreichs Gesundheitssystem zwar das zweitteuerste im EU-Vergleich ist, sich die gesunden Lebensjahre der Menschen dennoch schlechter entwickeln als im Europaschnitt.
Wo sind die Lücken im System, aus denen die Milliarden herausrinnen, die wiederum an anderen Stellen fehlen? Wer blockiert die Reformen, wer verhindert mehr Effizienz? Antworten liefert der 121-seitige Rechnungshof-Rohbericht „Ärztliche Versorgung im niedergelassenen Bereich 2018 bis 2023“, der profil und ORF exklusiv vorliegt.
Vorweg: Der Rechnungshof wird sich auf Gegenreaktionen einstellen müssen. Denn auf 121 Seiten leuchtet er gnadenlos die Schwachstellen des Systems aus – insbesondere stellt er einen Machtblock in ungewohnter Deutlichkeit in Frage: Die Funktionäre der Landesärztekammern.
Um die größte Bombe im Bericht zu verstehen, muss man sich an die türkis-blaue Krankenkassenreform zurückerinnern, deren zentrales Versprechen, aus einer Strukturreform die „Patientenmilliarde“ zu generieren, längst als Schmäh enttarnt wurde.
Damals sollten die neun Gebietskrankenkassen zur Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) verschmelzen - darüber wurde noch eine Dachebene eingezogen. Doch obwohl die Reform nun fünfeinhalb Jahre her ist, existieren – typisch Österreich – weiterhin neun Systeme: Welche Honorare die ÖGK an die Kassenärztinnen und Kassenärzte für deren Leistungen wie Wundversorgung, Blutabnahme oder EKG zahlt, ist in neun Verträgen mit den Landesärztekammern geregelt. Und die sind eben oft nicht einer Meinung. Die ÖGK hat diese Tariflisten von den Gebietskrankenkassen geerbt. Ein Beispiel, das stellvertretend für viele steht: Bei einem ärztlichen Gespräch erhält eine Ärztin im Burgenland knapp 13 Euro, ein Arzt in Oberösterreich kann dagegen 17 Euro verrechnen.
Für die Patienten bedeutet der Wildwuchs, dass sie in manchen Bundesländern Behandlungen als Kassenleistung bekommen, die anderswo kostenpflichtig sind. Die Muttermalkontrolle kostet in Niederösterreich etwa 60 Euro, in anderen Ländern zahlt die Kasse.
Reformvorhaben: einheitlicher Gesamtvertrag
Ein Ziel der Kassenreform war von Anfang an ein einheitlicher Gesamtvertag, der für Patienten und Ärzte mehr Einheitlichkeit und Fairness schaffen sollte. Der Rechnungshof nennt das Vorhaben „zentral“ für die Gesundheitspolitik. Einziges Problem: Es gibt ihn noch immer nicht.
Der Rechnungshof bemängelt in seinem Bericht, dass die ÖGK zwar gesetzlich verpflichtet wurde, mit den Ärztevertretern einen einheitlichen Gesamtvertrag zu paktieren, doch „Details – etwa eine Frist dafür oder die dafür aufzubringenden Mittel (…) waren nicht geregelt“. Bis Anfang 2025 wurden zwischen Kasse und Ärztevertetern zwar Positionspapiere ausgetauscht, es kam aber bisher zu keiner Annäherung. Das führe laut dem Prüfbericht dazu, dass „sowohl die Systemakzeptanz bei Ärztinnen und Ärzten sowie bei den Versicherten als auch die Steuerbarkeit der ÖGK beeinträchtigt“ werde.
Es sei schlicht „nicht plausibel“, warum bestimmte Leistungen beim selben Versicherungsträger bei gleichen Beiträgen vertraglich nicht verrechenbar waren. Aus Sicht der Prüfer befeuert der Fleckerlteppich an Leistungen den Trend zur Privatmedizin.
Woran scheitert es also? Die bestehenden Gesetze würden den Gesamtvertrag „erschweren“, weil neben der Österreichischen Ärztekammer derzeit auch die neun Länderärztekammern zustimmen müssten, so der Rechnungshof. Eine Einigung mit so vielen verschiedenen Player, die alle ihre heiligen Kühe verteidigen, kann ewig dauern – jedenfalls länger als fünfeinhalb Jahre.
Entmachtung der Landesärztekammer
Der Lösungsvorschlag des Rechnungshofs birgt Sprengstoff: Dem Gesundheitsministerium empfehlen die Prüfer wörtlich „eine Regierungsvorlage zur Änderung der Rahmenbedingungen vorzubereiten, etwa mit dem Entfall der Zustimmung der einzelnen Landesärztekammern“. Damit wären die Standesvertreter eiskalt entmachtet – mit Widerständen gegen diesen Vorschlag ist zu rechnen. Es ist unklar, ob sich SPÖ-Sozialministerin Korinna Schumann und ihre Staatssekretärin für Gesundheit, Ulrike Königsberger-Ludwig, das trauen. Und ob Neos und ÖVP da mitgehen.
Der Gesamtvertrag kann zwar für Einheitlichkeit sorgen und die Abrechnung auf Seiten der ÖGK erleichtern – großes Sparpotenzial sollte man sich davon aber nicht erwarten. Der Rechnungshof zitiert in seinem Bericht ÖGK-interne Berechnungen, die von Mehrkosten zwischen 350 Millionen Euro und 1,25 Milliarden Euro ausgehen.
Wo geht im zweitteuersten Gesundheitssystem Europas das Geld verloren? „Insgesamt war das österreichische System noch auf stationäre Versorgung und wenig auf Primärversorgung ausgerichtet“, urteilt der Rechnungshof im Rohbericht. Das bedeutet: Statt zum niedergelassenen Arzt zu gehen, landen viele Patienten in den Spitälern, obwohl das gar nicht notwendig wäre und das damit die teuerste Form der Behandlung ist.
Die hohen Kosten entstehen also zum Teil in der teuren Akutversorgung in Krankenhäusern – die qualitativ gleichwertig im niedergelassenen Bereich oder in der Primärversorgung erbracht werden könnten. Charakteristisch für das österreichische System sei, so der Rohbericht, „das weitgehende Fehlen einer Steuerung der Patientenwege durch die freie Wahl der Behandlungsstufe – Primärversorgung, Fachversorgung, Spitalsambulanz“.
Um Menschen medizinisch hochwertig und auch kosteneffizient zu versorgen, geht der EU-weite Trend seit Jahren weg von der teuren Stationsbehandlungen, hin zu ambulanten Untersuchungen. Für den Rechnungshof stechen dabei zwei österreichische Besonderheiten hervor: Im EU-Vergleich zieht es die österreichischen Patienten nicht in die Ambulanzen, sondern zu niedergelassenen Fachärzten.
Und gleichzeitig ist das Gesundheitswesen aus Patientensicht verwirrend – rund die Hälfte der Bevölkerung weisen Defizite in der „Gesundheitskompetenz“ auf – sprich: Viele Menschen haben Schwierigkeiten, sich im System zurechtzufinden, ob eine Ordination, eine Ambulanz oder ein Krankenhaus aufgesucht werden soll.
Budgetloch in der ÖGK
Die finanzielle Schieflage der ÖGK hat vor allem zwei Ursachen: Zum einen haben wegen der schwachen Wirtschaftslage viele Menschen ihren Job verloren. Arbeitslose sind weiterhin über die Pflichtversicherung der ÖGK versichert, zahlen mangels Einkommen jedoch keine Versicherungsbeiträge ein. Dadurch lagen die Einnahmen der Gesundheitskasse unter den Erwartungen – während die Ausgaben überproportional gestiegen sind. Zwischen 2018 und 2023 stand einem Einnahmenplus von 29 Prozent eine Kostensteigerung von 32 Prozent gegenüber – das ergibt ein sattes Defizit von 436 Millionen Euro. Ein Trend, der sich weiterziehen wird. Im Frühjahr ließ die Gesundheitskasse mit ihrer Prognose für 2025 aufhorchen: Sie erwartete ein negatives Ergebnis von 900 Millionen Euro. Seither wurden einige Gegenmaßnahmen eingeleitet, die das Defizit drücken sollen.
Die ÖGK nahm weniger ein als erhofft – gleichzeitig kletterten die Ausgaben rasant nach oben. Auf der Kostenseite legten laut Rechnungshof-Analyse vor allem „ärztliche Hilfe und gleichgestellte Leistungen“ (+39,3 Prozent), der Verwaltungsaufwand (+35,5 Prozent, profil berichtete) und Heilmittel (+32,3 Prozent) kräftig zu. Erstere, die ärztlichen Leistungen allein, stiegen im Prüfungszeitraum um 1,4 Milliarden Euro an. Laut Rechnungshof trugen die Ärztehonorare „im Zeitraum 2018 bis 2023 wesentlich zur Verschlechterung der finanziellen Lage der ÖGK bei“.
Die Prüfer fanden zur Kostenentwicklung ein paar Auffälligkeiten. Zwischen 2010 und 2023 – ausgenommen der Covid-19-Zeitraum – nahm die Zahl der vertragsärztlichen Konsultationen deutlich stärker zu als die Bevölkerung wuchs. Im Schnitt wurde pro Kopf also häufiger die e-Card gesteckt. Der Rechnungshof bezweifelt jedoch, dass allein die wachsende Zahl der älteren Menschen dafür verantwortlich ist, wie die ÖGK in offiziellen Presseaussendungen behauptet.
Denn den größten Anstieg der e-Card-Kontakte verzeichnete die Kasse ausgerechnet bei der Altersgruppe der 20- bis 49-Jährigen – mit einem Plus von 10,4 Prozent. Mangels Monitoring durch die Kasse kann der Rechnungshof nur mutmaßen, woran das liegt.
Spitzenverdiener Ärzteschaft
Von den massiven Ausgabensteigerungen der ÖGK profitierte vor allem eine Gruppe: Die Ärzteschaft. Vor allem Vertragsärzte gehörten mit 143.000 Euro brutto Medianverdienst (2015) zur Berufsgruppe mit dem höchsten Einkommen in Österreich, hält der Rechnungshof fest. 2022 steigerte sich der durchschnittliche Jahresverdienst auf 201.000 Euro.
Die Ärzteeinkommen sind „von 2015 bis 2022 im Median doppelt so stark gestiegen wie der Verbraucherpreisindex“, bilanziert der Rechnungshof. Das durchschnittliche Einkommen von niedergelassenen Ärzten mit Kassenvertrag stieg demnach um 41 Prozent – die durchschnittlichen Gehälter von Arbeitnehmern stiegen im Vergleichszeitraum um 23 Prozent.
Die Prüfer empfehlen deshalb der Gesundheitskasse, bei künftigen Tarifverhandlungen mit der niedergelassenen Ärzteschaft ihren bisherigen Verdienstzuwachs zu berücksichtigen. Sprich: Nicht mehr allzu viel draufzulegen.
Diesen Rat würde die ÖGK mit Sicherheit gerne befolgen – doch die Ärztekammer hat mit dem Bewerbermangel für Kassenarztstellen wie immer ein gewichtiges Argument in den Verhandlungen.
Fest steht, das Gesundheitssystem bleibt teuer. Ob es effizienter wird, hängt davon ab, ob Regierung und ÖGK die Vorschläge der Rechnungshofprüfer ernst nehmen.