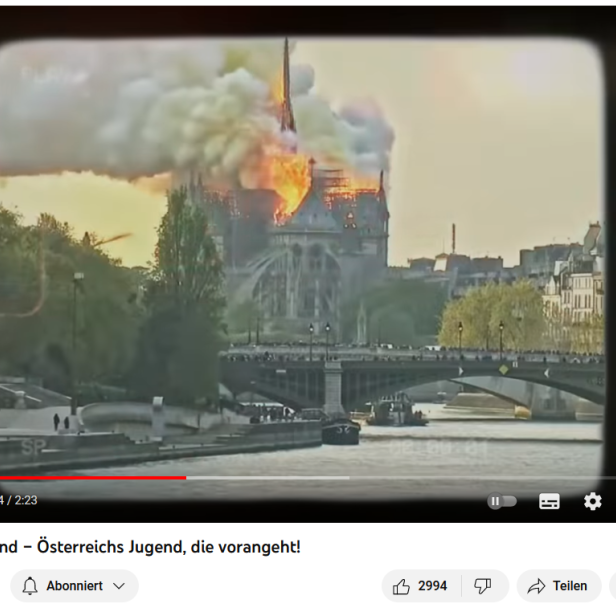Weniger Mut, neue Hürden: Was Reformen in der Politik erschwert
Die Töchter und Söhne mögen der meistdiskutierte Teil der österreichischen Hymne sein, häufiger wird aber eine andere Stelle zitiert. Politikerinnen und Politiker singen die erste Zeile der dritten Strophe mit besonderer Inbrunst, Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Ex-Kanzler Sebastian Kurz schrieben sie sogar auf ihre Plakate: „Mutig in die neuen Zeiten.“
„Mut wählen!“, appellierte auch SPÖ-Chef Andreas Babler auf seinen Sujets, als er noch in Niederösterreich kandidierte. Die Grünen wollten „mutig für Europa“ sein, die NEOS „mutig für die Zukunft“. Heinz-Christian Strache versprach als FPÖ-Chef „mehr Mut für unser Wiener Blut“. Mut ergibt sich aus dem Auge des Betrachters und aus den Umständen. Mut ist keine politische Kategorie, die sich leicht empirisch messen lässt. Womöglich schmücken sich die Parteien deswegen so gerne damit.
Die Regierungsspitze warb bisher eher mit Pragmatismus, Karl Nehammer und Werner Kogler mussten immerhin Pandemie und Krieg managen. Erst jetzt, im letzten Jahr vor der Nationalratswahl 2024, wäre Zeit für große Pakete wie Informationsfreiheit, Justizreform oder Klimaschutzgesetz, die ÖVP und Grüne seit Jahren versprechen.
Auf allzu mutigen Rückenwind aus der Bevölkerung sollten sich die Regierenden nicht verlassen: In einer aktuellen Umfrage von Unique Research für profil geben 55 Prozent der Befragten an, dass sie die Österreicherinnen und Österreicher allgemein weniger mutig als andere Europäer einschätzen. Geht Österreich also gar nicht „mutig in die neuen Zeiten“?
Auf engstem Raum
Tatsächlich war es vor 30 Jahren einfacher, große Reformen durchzusetzen, sagt Laurenz Ennser-Jedenastik, Politikwissenschafter an der Universität Wien. „Die Parteien konnten sich stärker auf Stammwähler verlassen, und der Gestaltungsspielraum im Parlament war größer.“ Jetzt liegen viele Kompetenzen bei der EU, die Höchstgerichte sind aktiver in ihrer Rechtssprechung, und es gibt mehr weisungsfreie Behörden. Der Raum, in dem die Politik national agieren kann, wird enger.
Es gibt aber auch zwei Faktoren, die heute Reformen erleichtern könnten. Krisen treiben Veränderungen an, genauso wie wechselnde Mehrheiten im Parlament. Je mehr Parteien in unterschiedlichen Konstellationen an der Macht sind, desto eher werden neue Projekte angegangen. Türkis-Grün habe einige Maßnahmen durchgesetzt, sagt Ennser-Jedenastik. Vielleicht auch aus diesen beiden Gründen. Die Große Koalition war stabil, Sozialdemokratie und Volkspartei blockierten einander in ihren Anliegen aber oft gegenseitig. „Die große Pensionsreform von Schwarz-Blau unter Schüssel wäre nicht möglich gewesen, wenn die SPÖ weiter in der Regierung geblieben wäre.“
Verpönte Regierung, unpopuläre Reform
Wer Österreich durch seine Regierung international in Verruf bringt, macht sich weniger Sorgen um das eigene Image. Vielleicht wurde Wolfgang Schüssel deswegen zum Vater des vermutlich unpopulärsten Reformkindes des Landes. Die Änderungen im Pensionssystem, die Schwarz-Blau Anfang der 2000er-Jahre beschloss, werden in vielen Fällen erst heute spürbar. Die Beamtenpension läuft aus, das Antrittsalter wurde erhöht und der Durchrechnungszeitraum ausgeweitet. Seitdem werden nicht mehr die besten 15 Versicherungsjahre zur Berechnung der Pensionshöhe herangezogen, der Zeitraum wird stetig ausgeweitet.
Die Reform war nachhaltig, aber nicht nachhaltig genug. „In den letzten Jahren gab es immer wieder außertourliche Pensionserhöhungen, die finanziell nicht gedeckt waren. Da hat eher der Mut gefehlt, den Senioren zu widerstehen“, findet Christoph Badelt, Präsident des Fiskalrates. Walter Pöltner trat 2021 daher sogar als Vorsitzender der Alterssicherungskommission zurück, sein Posten ist seither unbesetzt. „Mit der steigenden Lebenserwartung muss es auch eine Verschiebung des Pensionsantrittsalters geben“, sagt Badelt. Doch die gesunde Lebenserwartung ist nicht bei allen Menschen gleich. „Man braucht eine offene Diskussion, wie man jene nicht benachteiligt, deren Gesundheitszustand etwa durch ungesunde Arbeit schlechter ist.“ Es gehe nicht um eine „naive Anpassung“, sondern um eine Differenzierung, findet Badelt: „Wer immer in eine Regierung gehen will, müsste sich diesem Thema stellen.“
Vom EU-Beitritt überzeugt, und von der Neutralität?
Im politischen Wien der frühen 1990er-Jahre, Wolfgang Schüssel war gerade Wirtschaftsminister, sorgte man sich um zwei Dinge: die österreichische Identität und Ribisel. Die Republik sollte der Europäischen Union beitreten. Sämtliche Gegner des Projekts, und davon gab es viele, riefen das Ende der österreichischen Selbstständigkeit und Sprache aus. Als der EU-Vertrag 1995 in Kraft trat, hatte sich die Bundesregierung doppelt abgesichert. Im Protokoll Nr. 10 wurde die Verwendung von 23 österreichischen Begriffen in offiziellen EU-Dokumenten niedergeschrieben, damit die heimische Ribisel nicht zum Opfer der bundesdeutschen Johannisbeere wird. Und den Rückhalt der Bevölkerung hatte sie sich verpflichtend und schriftlich geholt. 66,6 Prozent stimmten bei der Volksabstimmung für den EU-Beitritt.
Diese Mehrheit mussten SPÖ und ÖVP hart verhandeln. Die Meinungsbildner, in diesem Fall vor allem Franz Vranitzky, SPÖ, und Alois Mock, ÖVP, bildeten eben eine Meinung, in Diskussionsveranstaltungen, mit der eigenen Partei, gegen die Freiheitlichen. Heute nennt Bundespräsident Alexander Van der Bellen das geeinte Europa „die beste Idee, die wir je hatten“. Sie war zwar nicht die Idee der Österreicherinnen und Österreicher, aber sie ließen sich davon überzeugen. Van der Bellen ist das beste Beispiel dafür, vor 30 Jahren war er immerhin noch Gegner des EU-Beitritts gewesen.
Eine Konsequenz möchten die meisten Politikerinnen und Politiker heute aber lieber ignorieren. Mit der Entscheidung für die EU veränderte sich auch Österreichs Neutralität. Sie schrumpfte, musste flexibler werden, in eine Beistandspflicht light passen und mit verschiedenen Kooperationspartnern umgehen lernen. Ob und in welcher Form die Neutralität das beste Modell ist, will an der Staatsspitze heute niemand diskutieren. Zu groß ist die Angst vor dem Unmut der Bevölkerung.
Irmgard Griss, ehemalige Höchstrichterin und NEOS-Abgeordnete, drängt aber vor allem nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine auf diese Debatte. Die Neutralität sei auf einen kleinen militärischen Kern reduziert, politisch existiere sie ohnehin nicht. Selbst Österreich habe eine Beistandspflicht in der EU. „Die Neutralität schützt auch nicht vor einem Angriff. Aber man rührt das Thema nicht an.“ Die Regierung müsste einen breiten Diskussionsprozess beginnen, mit offenem Ausgang. Möglich wären ein NATO-Beitritt, Bündnisfreiheit oder eben eine klar definierte Neutralität. Dass sich in Umfragen regelmäßig eine Mehrheit für den Status quo ausspricht, sei kein Argument, findet Griss. „Man klärt ja die Bevölkerung nicht darüber auf, was das alles bedeutet. Viele haben ein Bild von Neutralität, das nicht mit der Realität übereinstimmt.“ Außerdem könnte sich das Stimmungsbild – siehe EU-Beitritt – auch ändern, wenn man denn will.
Warmer Winter spart Emissionen
Neue Mehrheiten müssen nicht im Parlament entstehen, wie die Grünen nur zu gut wissen: Ab 1976 wurde erfolgreich gegen die Inbetriebnahme des Atomkraftwerks Zwentendorf demonstriert, im Dezember 1984 wurde durch die Besetzung der Hainburger Au deren Rodung verhindert. Beide Male waren spätere Grün-Politikerinnen und Politiker wie Parteigründerin Freda Meissner-Blau an vorderster Front dabei. Am zivilen Widerstand allein scheiterten die umstrittenen Bauvorhaben aber nicht. Vor allem der laute Aufschrei der „Kronen Zeitung“ dürfte die zunächst hinter der Umsetzung stehenden SPÖ-Regierungen in die Knie gezwungen haben.
Heute haben die Grünen zwar das Lobau-Camp gegen die Regierungsbank eingetauscht, viele dringend notwendige Maßnahmen im Kampf gegen die Klimakrise bleiben aber aus – auch wegen der Widerstände der ÖVP. „Das beste Beispiel ist Tempo 100 auf der Autobahn“, sagt Badelt: „Jeder Fachmann bestätigt, dass das eine bedeutende CO2-Emissions-Einsparung bringt. Aber die Politiker trauen sich nicht darüber.“
2022 reduzierte Österreich zwar seinen CO2-Ausstoß wie geplant, das lag aber auch am warmen Winter und den hohen Energiepreisen. Ein Klimaschutzgesetz mit festgeschriebenem Reduktionspfad hat Österreich seit 1. Jänner 2021 nicht mehr. Zwar helfen Klimaticket, Erneuerbaren-Ausbau und der schrittweise Ausstieg aus Öl und Gas, den Treibhausgasausstoß zu reduzieren, für einschneidende Maßnahmen scheint der Regierung aber der Mut zu fehlen: Statt Autofahren weniger attraktiv zu machen, kündigten ÖVP und Grüne zuletzt an, Autobahn-Vignetten von der Teuerung auszunehmen. Populistischer Kampf gegen die Teuerung statt unpopulärer Einschnitte gegen die Klimakrise.
Aber nicht alles liegt in der Hand der Bundesregierung. Täglich wird in Österreich eine Fläche von rund 16 Fußballfeldern verbaut. Den Flächenfraß zu stoppen, liegt aber in der Verantwortung von Bundesländern und Gemeinden. Die geteilte Verantwortung des Föderalismus bremst Reformen im kleinen Österreich. „Kombinierte Zuständigkeiten wie im Gesundheitsbereich sorgen für kompletten Stillstand“, sagt Badelt. Eine grundlegende Föderalismus-Reform, die die Aufgabenbereiche klar regelt, könnte viele Blockaden lösen. Doch ÖVP und Grüne haben sie sich, so wie viele Regierungen vor ihnen, nicht einmal vorgenommen.
„Das ist mangelnder Mut und mangelnde Umsetzungsfähigkeit“, analysiert Badelt: Der Föderalismus ließe sich nicht ohne die betroffenen Bundesländer reformieren, denn „das würden die innerparteilichen Strukturen keiner Partei überstehen“. Faktisch liegt die politische Macht in den Ländern. Die meisten Abgeordneten im Nationalrat erlangen ihr Mandat über Länder- oder Gemeindelisten – und die Bundesparteien sind finanziell stark von ihren Landesorganisationen abhängig.
Flächenfresser Föderalismus
In den laufenden Finanzausgleichsverhandlungen wird die Macht zwischen Bund, Ländern und Gemeinden zumindest in Teilen neu verteilt. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) machte über den Sommer vor allem Druck auf die Länder, Reformen im Gesundheitsbereich anzugehen. Dort bremsen nicht nur die Länder, auch Ärztekammer, Sozialversicherungsträger haben ihre eigenen Interessen.
Letztere zeigen, dass Mut nicht immer gut ist: Gegen lauten Widerstand der Arbeitnehmervertretung fusionierten ÖVP und FPÖ die neun Gebietskrankenkassen. Einen einheitlichen Leistungskatalog für ganz Österreich gibt es auch drei Jahre nach der Reform nicht, die versprochene „Patientenmilliarde“ blieb gänzlich aus. „Es war nur der Mut zum politischen Konflikt da, aber nicht zu einer weitgehenden, sachlichen Reform“, sagt Badelt.
Aus Sicht von Politikwissenschafter Ennser-Jedenastik könnte sich die Politik mehr trauen: „Die meisten Reformen haben keine unmittelbaren Auswirkungen auf das Wahlverhalten.“ Die Arbeit einer ganzen Legislaturperiode hat Einfluss auf das Wahlverhalten, eine einzelne Maßnahme aber in den meisten Fällen nicht. Es bleibe das Risiko, eine bestimmte Gruppe zu vergrämen – aber auch die Chance, neue Gruppen zu überzeugen. Mit Blick auf schwache Umfragewerte haben ÖVP und Grüne wenig zu verlieren. Die Regierung könnte umstrittene Reformen daher knapp vor der Wahl präsentieren. Wenn nicht aus Mut, dann aus Überlebenswillen.