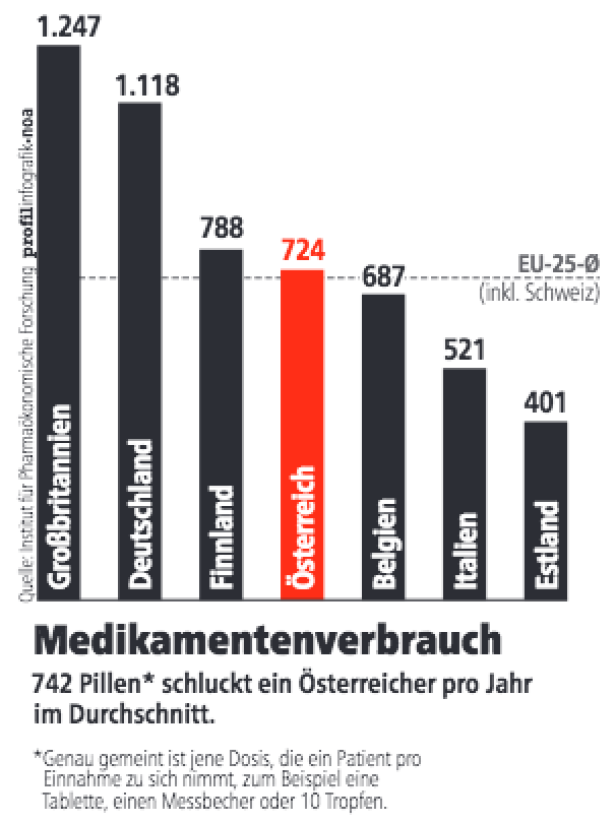Tödliche Medikamente: Das Risiko der Nebenwirkungen
Helene Schenker*, 80, war in guter Verfassung. Sie wohnte allein in einer kleinen Wohnung und versorgte sich selbst. Die Einnahme ihrer sechs Medikamente hatte sie im Griff: zwei gegen den Bluthochdruck, eines gegen Altersdiabetes, zwei gegen die Gelenksabnutzung in der Hüfte, eines gegen ihre Depressionen. Als Schenkers Unterschenkel schmerzhaft anschwollen, diagnostizierte der Hausarzt Ödeme und verordnete ein Präparat gegen das Wasser in den Beinen. Einige Tage lang nahm sie das Medikament und wurde immer verwirrter. Beim Besuch ihres Sohnes konnte ihm Helene Schenker nicht einmal mehr ihren eigenen Namen nennen. Er rief die Rettung, es war höchste Zeit: Die Frau litt an einer lebensbedrohlichen Hyponatriämie, einer Störung des Wasserhaushalts. Die Spitalsärzte setzten das gegen die Ödeme verordnete Mittel sofort ab und reduzierten das Antidepressivum. Ein böses Zusammenspiel der beiden Präparate war mit hoher Sicherheit verantwortlich für Schenkers Zusammenbruch. Möglicherweise hatte sich noch ein weiteres ihrer Medikamente ungünstig eingemischt.
Wie interagieren Medikamente miteinander?
In den USA sind Arzneimittelneben- und Wechselwirkungen die vierthäufigste Todesursache. In Deutschland sterben mindestens vier Mal so viele Menschen an den Folgen von Medikamenten wie im Straßenverkehr. Für Österreich gibt es keine konkreten Zahlen, Experten gehen allerdings von ähnlichen Ziffern aus. Kein Zweifel: Arzneimittel retten Leben und lassen uns immer älter werden. Doch je älter wir werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Wirkstoffe - möglicherweise sogar die über Jahre lebenserhaltenden - gegen den Organismus wenden.
Gut ein Fünftel aller Österreicher über 60 Jahre erhält fünf oder mehr verschiedene Medikamente. Ab dieser Menge spricht die Weltgesundheitsorganisation WHO von Polypharmazie. Wie diese Cocktails wirken, weiß niemand so genau. Neben den allseits bekannten Nebenwirkungen kommen bei der Kombination von Arzneien auch Wechselwirkungen zum Tragen. Viele Mittel beeinflussen sich gegenseitig - manchmal sogar mit tödlichem Ausgang. Ärzte stehen häufig vor einem Dilemma: Wie viele Wirkstoffe müssen sie verschreiben, um ihren Patienten ein schmerzfreies Leben zu ermöglichen? Wann ist es zu viel? Wie interagieren die Medikamente miteinander? Gibt es noch unbekannte Neben- oder Wechselwirkungen?
Oft beginnt mit der ersten Nebenwirkung ein Teufelskreis wie bei Helene Schenker: Wegen ihrer Schlafstörungen bekam sie im Krankenhaus ein Beruhigungsmittel, das sie benommen machte. Auf dem Weg zur Toilette stürzte sie und brach sich den Oberschenkel. Zu der Verletzung kam eine Lungenentzündung, die Antibiotika nötig machte, die wiederum zu einem Nierenversagen führten. Die Nieren waren durch die Diabetes und das Antirheumatikum gegen die Hüftgelenksarthrose bereits geschwächt gewesen. Nach mehreren Wochen im Spital und einem Reha-Aufenthalt war klar: Schenker würde als Pflegefall nicht mehr in ihre Wohnung zurückkehren können.
Jedes Medikament, das man spart, ist ein doppelter Gewinn
Mit jedem zusätzlichen Medikament steigt das Risiko für Wechselwirkungen. Besonderes Interaktionspotenzial haben Antidepressiva, Blutverdünner und manche Antibiotika. Hinzu kommt, dass die Patienten schnell den Überblick verlieren. Je mehr Pillen, Tropfen, Salben zum Einsatz kommen, desto größer ist die Fehlerquote bei der Anwendung. "Jedes Medikament, das man spart, ist ein doppelter Gewinn", sagt Markus Zeitlinger, Leiter der Uniklinik für Klinische Pharmakologie der Medizinischen Universität Wien. Er steht Österreichs erster Ambulanz für rationale Arzneimitteltherapie und Interaktionen im Wiener Allgemeinen Krankenhaus vor, die Anfang dieses Jahres gegründet wurde. Dort überprüfen Apotheker, klinische Pharmazeuten und spezialisierte Internisten die Therapien schwerkranker Patienten, vorerst allerdings nur jener, die bereits AKH-Betten belegen. "Mehr können wir momentan nicht schaffen", sagt Zeitlinger.
Erschreckendes enthüllte eine Untersuchung in den Salzburger Landeskliniken 2008. Drei Monate lang hatten Ärzte und Pharmakologen die Medikation aller neu aufgenommenen Patienten über 75 Jahre analysiert. Ergebnis: Knapp ein Drittel nahm Mittel, die für alte Menschen nicht empfehlenswert waren. Bei einem weiteren Drittel der Patienten fanden die Forscher verzichtbare Medikamente, bei einem Viertel gab es Fehldosierungen. Knapp ein Fünftel der Senioren war gar erst wegen unerwünschter Arzneimittelwirkungen im Krankenhaus gelandet. Besonders betroffen waren Frauen, an mehreren chronischen Krankheiten leidende Patienten und Menschen mit Niereninsuffizienz.
Akne Inversa ist eine äußerst unangenehme Erkrankung der Haut. Sie beginnt mit Entzündungen der Haarwurzeln in Achselhöhlen, Leisten und im Genitalbereich, die sich zu großflächigen Abszessen und Fisteln ausweiten können. Maximilian Ledochowski, Facharzt für Innere Medizin in Innsbruck, versuchte, seinem an schwerer Akne Inversa leidenden Patienten Lukas Kaiser* mit allen Mitteln zu helfen - vergeblich. Schließlich schickte er ihn in eine Klinik, die den jungen Mann mit einem neuen Mittel therapierte. Der Wirkstoff Adalimumab hemmt jenen Zellstoff im Immunsystem, der Entzündungen auslöst. Kaiser erholte sich schnell, sollte das Medikament aber länger bekommen.
Zurück in Ledochowskis Praxis stellte Lukas Kaiser wichtige Fragen: Wie würde sich das neue Mittel mit seiner Diabetestherapie vertragen? Könnte es Wechselwirkungen mit seinen Antidepressiva geben? Sollte er lieber auf andere Präparate umsteigen? Ledochowski konnte keine einzige Frage beantworten. Im Beipackzettel waren die betreffenden Wechselwirkungen nicht aufgeführt, Literatur- und Internetrecherche blieben erfolglos. Also wandte sich der Arzt direkt an den Hersteller. Kein leichtes Unterfangen. "Früher konnte man einen Produktmanager anrufen. In letzter Zeit scheiterte ich regelmäßig an den Telefonzentralen von Pharmaunternehmen", sagt Ledochowski. Ein zeitlicher Aufwand, den sich im Alltag die wenigsten Ärzte leisten können.
Ledochowski bekam nach mehreren Anläufen schließlich eine Antwort per E-Mail: Der Hersteller hatte keine Studien über Wechselwirkungen anzubieten, weder für das angefragte Antidepressivum noch für Lukas Kaisers Antidiabetikum. Der Pharmakonzern konnte lediglich auf einen veröffentlichten Fall hinweisen, bei dem Mediziner bei einer Patientin eine Interaktion mit Kaisers Antidepressivum beobachtet hatten. Die Patientin hatte an einer Neuropathie gelitten, die sich nach der Gabe von Adalimumab deutlich verschlechtert hatte.
Jährlich 30 bis 40 neue Medikamente zugelassen
Zu den bestehenden 15.000 in Österreich zugelassenen Arzneien kommen jährlich 30 bis 40 neue hinzu. Werden neue Medikamente vorab nicht auf Wechselwirkungen getestet? Durchaus: Sie müssen zuerst in der Petrischale auf Interaktionen untersucht werden. Das schreibt die europäische Zulassungsbehörde EMA vor. Dazu werden die neuen Stoffe über Leber-und Nierenzellen geschüttet, um zu beobachten, wie sie abgebaut werden. Denn grundsätzlich gilt folgende Faustregel: Alle Mittel, die in Leber oder Niere denselben Abbauprozess durchlaufen, reagieren auch miteinander. Bilden sich in vitro also jene Enzyme, die üblicherweise für Wechselwirkungen verantwortlich sind, muss das neu entwickelte Medikament weitere klinische Studien durchlaufen. Gesunde Probanden bekommen es dann in Kombination mit jenen Wirkstoffen, die in der Leber genau gleich verstoffwechselt werden. Allerdings werden meist nur jeweils zwei Mittel getestet und so auf Wechselwirkungen geprüft. Was aber passiert, wenn drei oder mehr aufeinandertreffen, ist für Ärzte schwer abzuschätzen. Umso wichtiger wäre es, bei jedem Patienten die bestehenden Medikamente zu überprüfen, nicht mehr nötige abzusetzen und für potenziell wechselwirkende Ersatz zu finden - eine manchmal lebensrettende Maßnahme, die aus Zeitmangel immer wieder auf der Strecke bleibt.
Wir haben hier die Büchse der Pandora geöffnet. Das Risiko tragen derzeit Arzt und Patient allein.
Warum wurde Kaisers Präparat gegen die Akne Inversa nicht näher auf Wechselwirkungen untersucht? Adalimumab zählt zu der Medikamentengruppe der Biologicals, relativ neuen Wirkstoffen, die körpereigenen Proteinen ähneln und direkt auf das Immunsystem wirken. Sie sind eine der zukunftsträchtigsten Medikamentengruppen der Pharmaindustrie. Sie werden im Körper auf spezielle Weise abgebaut, weshalb sie die herkömmlichen Tests in der Petrischale bestehen. "Wir haben hier die Büchse der Pandora geöffnet. Das Risiko tragen derzeit Arzt und Patient allein. Der Gesetzgeber muss Regeln schaffen, denen zufolge Pharmakonzerne Biologicals zumindest mit den gängigsten Medikamenten in klinischen Studien testen müssen", fordert der Mediziner Ledochowski. Er steht oft vor heiklen Entscheidungen: Kann er seinen schwerkranken Patienten, die häufig an Morbus Crohn oder Schuppenflechte-Schüben leiden, die hoch wirksamen Biologicals verschreiben, auch wenn sie weitere Medikamente nehmen müssen? Im Fall von Lukas Kaiser entschied sich Ledochowski dafür; die gefürchteten Wechselwirkungen blieben aus.
Pharmazeuten haben sich im Studium viel genauer mit Arzneistoffen beschäftigt als Mediziner
Viele Österreicher sind kritische Patienten. Einer Online-Umfrage des Gallup-Instituts zufolge lesen 84 Prozent den Beipacktext genau durch, 40 Prozent haben schon einmal ein verschriebenes Medikament nicht genommen, weil sie Nebenwirkungen fürchteten. Das dürfte nicht zuletzt an den Ärzten liegen. Die Hälfte der Befragten gab an, bei Verschreibungen nicht über Nebenwirkungen aufgeklärt worden zu sein. Der niederösterreichische Patientenanwalt Gerald Bachinger empfiehlt, sich zusätzlich Rat vom Apotheker zu holen: "Pharmazeuten haben sich im Studium viel genauer mit Arzneistoffen beschäftigt als Mediziner."
E-Medikation als Lösungsansatz?
Was kann die e-Medikation an der derzeitigen Situation ändern? In Deutschlandsberg, Hartberg-Fürstenfeld, Leibnitz, Südoststeiermark und Weiz wurde im vergangenen März eingeführt, was Experten seit Langem forderten: Kassenärzte sind nun dazu verpflichtet, verordnete Medikamente auf der E-Card zu speichern. Besteht die Gefahr von Wechselwirkungen, schlägt das System Alarm. Löst der Patient sein Medikament in der Apotheke ein, wird das ebenfalls dokumentiert. Apotheker müssen zudem knapp 400 rezeptfreie Arzneimittel einspeisen, die dafür bekannt sind, Wechselwirkungen auszulösen. Die Daten werden für ein Jahr auf der Gesundheitsakte ELGA gespeichert. Per Handysignatur oder Bürgerkarte kann künftig auch jeder Patient selbst nachsehen, was ihm verschrieben wurde.
Ärzte mussten sich bisher selbst Softwaresysteme zulegen, die sie vor gefährlichen Kombinationen und Nebenwirkungen warnten - wenn sie daran interessiert waren. "Der Skandal ist, dass wir die e-Medikation erst jetzt einführen. Technisch möglich wäre sie schon lange", sagt Christoph Baumgärtel von der Arzneimittelagentur AGES. Vor allem die Ärztekammer hatte die einheitliche Datenbank hartnäckig ausgebremst.
Im April werden nun die restlichen Regionen der Steiermark technisch aufgerüstet, im Mai folgt Graz. Bis September 2019 soll das gesamte Bundesgebiet Teil der e-Medikation sein. Die Erwartungen sind groß: Wechselwirkungen könnten um die Hälfte reduziert werden, schätzen Experten. Im Pilotversuch erklang das betreffende Warnsignal immerhin bei jedem zweiten Arztbesuch. Auch mit Doppelverordnungen soll nun Schluss sein. 15 Prozent aller Patienten in Österreich bekommen derzeit denselben Wirkstoff zwei Mal verschrieben. So verordnet zum Beispiel der Hausarzt das Originalpräparat, dann der Facharzt das wirkstoffgleiche Generikum, ohne voneinander zu wissen.
Wir brauchen mehr Spezialisten für Arzneimittelinteraktionen, an die sich Ärzte wenden können
Praktiker, Internisten und Psychiater: Sie verschreiben sowohl die meisten als auch die gefährlichsten Medikamente. Die e-Medikation wird ihre Arbeit erleichtern, aber auch Fragen aufwerfen. "Wir brauchen mehr Spezialisten für Arzneimittelinteraktionen, an die sich Ärzte wenden können", fordert Markus Zeitlinger von der MedUni Wien.
Vorarlberg hat bereits eine zweimonatige Testphase absolviert. "Wirklich auf die e-Medikation verlassen kann man sich noch nicht", resümiert der Vorarlberger Ärztekammer-Vizepräsident Burkhard Walla. Noch sei das Projekt ein "wildes Stückwerk", weil Wahlärzte und Spitäler nicht verpflichtend teilnehmen müssen. Wegen dieser Lücken kämen Ärzte weiterhin um eine ausführliche Medikamentenanamnese nicht herum: "Alles andere wäre fahrlässig", sagt Walla. Was die e-Medikation kaum lösen wird: Ein Arzt braucht für eine umfassende Überprüfung einer längeren Medikamentenliste etwa zwei Stunden - Zeit, welche die wenigsten Mediziner aufbringen können.
Als Holger Martin im November 2015 seinen HNO-Arzt aufsuchte, ahnte er nicht, dass dieser Termin sein Leben verändern würde. Eine hartnäckige Pilzinfektion im linken Ohr quälte ihn, der Arzt verschrieb ihm Tropfen mit einem Breitband-Antibiotikum aus der Gruppe der Fluorchinolone. Martin, selbst praktizierender Mediziner, begann mit der Therapie, die vorerst bestens anschlug. "Zwei Monate nach dem Einträufeln begannen sich meine Fußsohlen pelzig anzufühlen", sagt Martin. Als das linke Auge und der Mundwinkel schlapp und die Zunge taub wurden, suchte er Hilfe im Spital. Den Zusammenhang mit den Ohrentropfen stellte niemand her, auch der Mediziner selbst nicht.
Erst eine eingehende Recherche über den Wirkstoff brachte Martin darauf. In den USA wurden Ärzte und Patienten im Beipackzettel eindringlich vor dem Breitband-Antibiotikum mit den Handelsnamen Ciprofloxacin, Moxifloxacin, Levofloxacin und Ofloxacin gewarnt. Der Grund: schwere Nebenwirkungen (Lähmungen, Neuropathien, Sehnenrisse, Lungenprobleme, Magen-Darm-Beschwerden, Herzrasen, Halluzinationen, Depressionen) sowie Wechselwirkungen. Die zusätzliche Einnahme von Neuroleptika, Antidepressiva, Antiasthmatika und Antirheumatika kann Herzrhytmusstörungen auslösen. Seit 2016 führte die US-Arzneimittelbehörde die Nebenwirkungen des Antibiotikums als eigene Krankheit unter dem Namen Fluoroquinolone-Associated Disability (FQAD). Freilich treten diese nicht bei allen Patienten auf. Experten schätzen, dass sie etwa einen von 1000 betreffen.
Die amerikanische Arzneimittelbehörde empfiehlt das Mittel nur noch bei schweren Infektionen wie Milzbrand oder Pest. "Ein Verbot des Medikaments ist kaum möglich. Wegen der starken Resistenzen können wir auf kein Antibiotikum verzichten", sagt Christoph Baumgärtel von der AGES, die für die Zulassung von Arzneimitteln zuständig ist. Seine Behörde hat die heimische Ärzteschaft in den vergangenen Jahren mehrmals ermahnt, Fluorchinolone nicht wie früher bei banalen Blasen-, Nasen-, Ohrenentzündungen oder Bronchitis zu verschreiben. Es werde nun deutlich weniger verwendet, so Baumgärtel.
Auch die europäische Arzneimittelagentur bewertet das Risiko der Fluorchinolone nun neu und wird wahrscheinlich deutlichere Warnungen im Beipackzettel verlangen. Zu spät für Holger Martin und viele andere. Martin wird mit seinen Behinderungen leben müssen - der Großteil der Schäden ist irreversibel . Schuld an seiner Misere seien die Pharmaunternehmen, sagt er: "Sie hätten auch in Europa schon früher stärker warnen müssen." Seine Anwälte halten es für aussichtslos, gegen den Hersteller zu klagen. Größere Chancen hätte Martin, gegen seinen HNO-Arzt vorzugehen. Doch das will er nicht: "Ich mache ihm keinen Vorwurf. Hätte er von den extremen Nebenwirkungen gewusst, hätte er mir das Mittel sicher nicht verschrieben."
Patientenanwalt Gerald Bachinger sieht das ähnlich. "Die Pharmakonzerne sichern sich im Beipackzettel gegen eine ganze Latte von Nebenwirkungen ab. Würden die Ärzte penibel alle berücksichtigen, dürften sie gar nichts mehr verordnen." Trotzdem stünden Mediziner wegen Nebenwirkungen so gut wie nie vor Gericht. Seinen Arzt erfolgreich zu verklagen, wäre in Österreich nur dann sinnvoll, wenn man ihm eine Kontraindikation vorwerfen könnte, wenn er also zum Beispiel das falsche Medikament für eine Krankheit verschrieben hätte. Oder man müsse seinem Arzt beweisen, dass er über die Nebenwirkungen nicht ausreichend aufgeklärt hat. "Dann steht es aber Aussage gegen Aussage", so Patientenanwalt Bachinger.
Mehr Chancen auf Erfolg vor Gericht rechnen sich die Opfer des jüngsten Medikamenten-Skandals um das Haarwuchsmittel Finasterid aus. In den 1990er-Jahren gegen Prostatavergrößerungen entwickelt, erkannte man schnell das Sprießen der Haarpracht, den das hormonhaltige Präparat auslöste. Es wurde zum weltweiten Verkaufsschlager, auf den auch der amerikanische Präsident Donald Trump schwören soll. Doch seit einigen Jahren häufen sich Beschwerden: Zehntausende Männer berichteten von Libidoverlust, Impotenz, Ejakulationsstörungen und Depressionen. Bei vielen verschwanden die Symptome nach dem Absetzen von Finasterid, bei manchen aber blieben sie: "Ich wollte keine Glatze. Die Pille, die der Arzt mir gab, hat mein Leben zerstört", sagte ein deutscher Betroffener kürzlich in der Wochenzeitung "Die Zeit". Er verklagt nun den Hersteller des Nachahmer-Präparats Dermapharm auf Schadensersatz. In den USA laufen mehr als 1000 Gerichtsverfahren gegen Merck, den Produzenten des Originals.
Dieser Fall zeigt einmal mehr: Manch fatale Nebenwirkung bringt erst die Zeit ans Licht. Möglicherweise ein Anlass, sich an eine alte ärztliche Faustregel zu erinnern, die besagt: Traue keiner Arznei, die kürzer als fünf Jahre auf dem Markt oder im strengen Skandinavien nicht zugelassen ist.
*Name von der Redaktion geändert