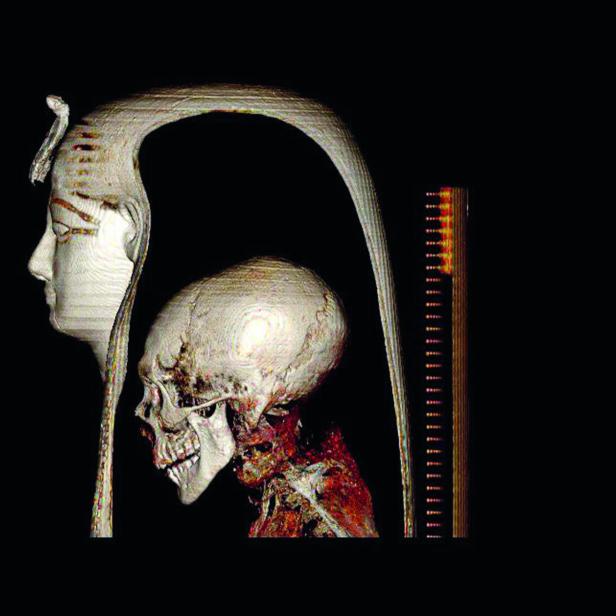Statistik beweist: Wir werden alle sterben!
Wer in den vergangenen Wochen mutig genug war, Corona-Postings in sozialen Medien zu lesen, kam an einer Meldung nicht vorbei: Impfungen erhöhen das Sterberisiko. Statistiken würden klar zeigen, dass in Regionen mit hoher Impfquote besonders viele Todesfälle auftreten. Ist so eine Behauptung erst einmal in der Welt, speziell in Zeiten großer Verunsicherung, verbreitet sie sich wie ein Lauffeuer. Im Netz hält sich daher hartnäckig die Botschaft: Wer impfen geht, riskiert sein Leben.
Was aber belegen die Statistiken wirklich? Dieser Frage haben sich vier zahlenaffine Wissenschafterinnen und Wissenschafter angenommen: der Bochumer Ökonom Thomas A. Bauer, der Berliner Psychologe Gerd Gigerenzer, der Dortmunder Statistiker Walter Krämer und die Münchner Datenexpertin Katharina Schüller. Das Team betreibt die Website „Unstatistik des Monats“, die das Ziel verfolgt, anhand konkreter Beispiele über die vielen Feinheiten, Fallstricke und Fehlschlüsse von Statistiken aufzuklären. Seit zehn Jahren existiert der Service, doch in Pandemiezeiten kommen die Forschenden kaum damit nach, all die Irrtümer und verzerrten Interpretationen aufzuzeigen, die aus vermeintlich unschuldigem Zahlenwerk abgeleitet werden und nicht selten irrationale Ängste schüren.
Der behauptete Zusammenhang zwischen Impfquote und Übersterblichkeit beruht auf dem Klassiker statistischer Schnitzer schlechthin: der Verwechslung von Korrelation und Kausalität. Nur weil zwei Ereignisse zeitgleich auftreten, heißt das längst nicht, dass eines das andere verursacht. Bei manchen Korrelationen ist das offensichtlich. Sie sind so absurd, dass man von „Nonsens-Korrelationen“ spricht. So korreliert die Höhe der US-Ausgaben für Wissenschaft perfekt mit der Selbstmordrate durch Erhängen.
Die Zahl der Todesfälle durch Ertrinken im Swimmingpool wiederum korreliert mit dem Kinostart von Filmen, in denen Nicolas Cage mitspielt. Ein bereits alter Hut ist der Umstand, dass in manchen Gegenden die Zahl der Störche mit der Geburtenrate korreliert. Weniger geläufig dürfte sein, dass Haarausfall bei Männern mit steigendem Einkommen korreliert.
An den Daten selbst ist nicht zu rütteln. Sie stimmen, und trägt man sie auf einer Grafik ein, ergeben sich wunderschöne, gleich verlaufende Kurven. Dennoch sind sie unsinnig und besitzen keine Aussagekraft. Wie kann das sein?
Die Erklärung ist, dass eine dritte Variable existiert, welche die beiden anderen erhellt. So nisten am Land mehr Störche als in Städten, und in ländlichen Gebieten ist tendenziell auch die Geburtenrate höher. Die Lösung des Glatzenrätsels: Mit zunehmendem Alter verlieren viele Männer ihre Haarpracht, gleichzeitig steigt die Chance auf besser bezahlte Jobs. Der dritte Faktor ist in dem Fall schlicht die Zeit. Sie verbindet und erklärt die beiden anderen, die nur in Korrelation zueinander stehen.
Wie verhält es sich nun mit Impfungen und Übersterblichkeit? Ziemlich sicher handelt es sich ebenfalls um eine Nonsens-Korrelation, die bloß weniger augenfällig ist als bei jener, in der Störche für den Kindersegen sorgen. Tatsächlich gibt es Regionen, in denen über bestimmte Zeitabschnitte bei hohen Impfraten viele Todesfälle auftreten (während es in anderen Gegenden umgekehrt ist; konsistent ist diese Beobachtung keineswegs).
Was aber besagt dieser Umstand? Wohl gar nichts. Denn hier liegt das Phänomen der umgekehrten Kausalrichtung vor. Wenn sich viele Menschen mit dem Virus anstecken (wie im vergangenen Herbst), steigt auch das Risiko schwerer und tödlicher Verläufe. In solchen Situationen sind zugleich mehr Menschen bereit, sich impfen zu lassen – und schon steigen Impfquote und Sterberate parallel zueinander. Eine höhere Sterberate führt also zu mehr Impfungen, und nicht umgekehrt.
Ist damit aber schon ausgeschlossen, dass Impfungen zu vermehrten Todesfällen führen? Nicht zwangsläufig, aber wenn man solch einen Zusammenhang in den Raum stellt, muss man ihn auch belegen können, sonst verbreitet man bloß Panik.
Die Pandemie mag besonders fruchtbar für datenbasierte Desinformation sein, etwa über das Bedrohungspotenzial des Coronavirus oder die Sicherheit von Impfungen. Doch auch in den Jahren davor fand das Team der Unstatistik ausreichend Material, das eine kritische Würdigung verdiente.
Sehr oft werden mit missverständlich präsentiertem Zahlenwerk maßlos übertriebene Vorstellungen von Umweltrisiken, gesundheitlichen Gefahren oder vom Nutzen medizinischer Maßnahmen provoziert. Indem die Expertengruppe erläutert, wie Statistiken zustande kommen, wie man Daten richtig liest und wo Stolperfallen lauern, will sie den Menschen das notwendige Rüstzeug vermitteln, um sich gegen irreführende Risikokommunikation zu wappnen.
Die Idee dazu hatte Thomas Bauer, Professor für empirische Wirtschaftsforschung, als er eines Morgens Zeitung las und darin von Einkommensungleichheiten berichtet wurde, die angeblich zu sozialen Unruhen führen würden. „In der Meldung waren aber statistische Fehler“, erinnert sich Bauer.
Anschließend hätten er und der Statistiker Walter Krämer den Plan zur „Unstatistik“ gefasst und Gerd Gigerenzer dafür begeistern können. Katharina Schüller kam etwas später dazu. Seit 2012 publiziert das Team nun Monat für Monat eine Unstatistik – Zeit für ein Best-of: zehn Highlights aus zehn Jahren.
1 Drink gefährdet die Gesundheit!
Im Jahr 2018 sorgte die Warnung für Aufregung, dass schon ein einziger Drink pro Tag das Risiko für alkoholbedingte Erkrankungen erhöhe, und zwar um 0,5 Prozent. Heißt das, dass von 200 Personen eine krank wird, weil sie sich täglich ein Achtel Wein gönnt? Nein. Es handelt sich um die zweite große statistische Verirrung neben der Verwechslung von Korrelation und Kausalität: um die Angabe von relativen Risiken, mit denen man Gefahren maßlos übertreiben kann – und deren Verwendung daher eigentlich verpönt ist.
Seriöser ist die Nennung eines absoluten Risikos. Die Schlüsselfrage lautet dabei, um wie viele Personen mehr erkranken, weil sie einen Drink nehmen, verglichen mit jenen, die abstinent leben. Die Basisdaten stammten aus dem Medizinjournal „The Lancet“ und zeigten: Von 100.000 Menschen, die nie trinken, erkrankten im beobachteten Jahr 914. Bei Menschen, die einen Drink pro Tag zur Brust nehmen, stieg diese Zahl auf 918. Der absolute Risikoanstieg betrug also vier Personen oder 0,004 Prozentpunkte. Das hätte wohl kaum jemanden vom Griff zum Gläschen abgehalten.
18% mehr Darmkrebs durch Wurst!
Gehöriges Aufsehen erregte auch die Behauptung der WHO 2015, wonach moderater Konsum von Wurst und rotem Fleisch das Darmkrebsrisiko um alarmierende 18 Prozent erhöhe. Es handelt sich neuerlich um die irreführende Nennung eines relativen Risikos (auch profil kritisierte damals die Kommunikation der WHO). Denn natürlich erkranken nicht 18 von 100 Menschen, die gerne Salami essen, an Darmkrebs. Genau dieser Eindruck wurde aber erweckt.
Um wieder das absolute Risiko zu ermitteln, muss man zunächst wissen, wie viele Menschen generell an Darmkrebs erkranken. Das sind etwa fünf Prozent der Bevölkerung. Was heißt nun 18 Prozent mehr Risiko? Es heißt, dass nun rund sechs Prozent Gefahr laufen, Darmkrebs zu bekommen. Das absolute Risiko steigt um einen Prozentpunkt.
34% mehr Parkinson durch Magermilch!
Im Jahr 2017 gab es schlechte Nachrichten für all jene, die fettarme Milch und Joghurts schätzen: Ihr Risiko, an Parkinson zu erkranken, steigt laut zweier Studien in einem Fachjournal um schockierende 34 Prozent. Schon eine Portion täglich erhöhe die Gefahr für das neuro-degenerative Leiden.
Natürlich wurde auch hier ein relatives Risiko genannt. Tatsächlich stellt sich das Bedrohungspotenzial weit weniger dramatisch dar: Das allgemeine Risiko für Parkinson beträgt etwa 0,6 Prozent.
Der Konsum fettreduzierter Milchprodukte erhöht dieses Risiko angeblich auf ein Prozent. Der absolute Risikoanstieg beträgt also 0,4 Prozentpunkte. Falsch sind die 34 Prozent freilich nicht, sondern bloß irreführend: Wenn die Gefahr von 0,6 auf eins steigt, sind das relativ 34 Prozent.
In dem Fall gelang es sogar, gleich beide statistischen Kardinalfehler elegant zu vereinen: Den Nachweis eines Kausalzusammenhangs blieben die Studien selbst bei dem absolut minimalen Risikoanstieg nämlich schuldig.
23% weniger Diabetes dank veganer Kost!
Ein letztes Beispiel noch aus der Reihe relative Risiken, weil sie häufig benutzt werden, um Gefahren aufzublähen – oder um den Nutzen einer Maßnahme gewaltig zu übertreiben, wie in einem Beispiel aus dem Sommer 2019: Wer sich vegetarisch oder vegan ernähre, senke das Risiko für Diabetes vom Typ II um beeindruckende 23 Prozent, also um fast ein Viertel. Wie so oft war es ausgerechnet ein Fachjournal, das sich der Unsitte der Nennung einer relativen Risikoreduktion bediente.
Was also nützt Kost ohne Tierprodukte wirklich? In der Studie wurde ein generelles Diabetes-II-Risiko von 7,7 Prozent ausgewiesen. Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernährten, senkten diese Gefahr auf 5,9 Prozent. Der Abstand zwischen den beiden Werten beträgt relativ tatsächlich 23 Prozent, absolut hingegen 1,8 Prozentpunkte, was nicht ganz so großartig klingt.
Alle 11 Minuten eine neue Liebe!
Viele Menschen werden noch den Slogan einer Partnerbörse im Gedächtnis haben, wonach alle elf Minuten zwei vormalige Singles zueinanderfänden. Ist das eine gute Quote? Das Autorenteam der „Unstatistik“ rechnete ganz unromantisch nach und kam (auf Basis der damaligen Mitgliederzahl von fünf Millionen und einer gerundeten Trefferquote alle zehn Minuten) zu einem ernüchternden Ergebnis: Wenn unter fünf Millionen alle zehn Minuten ein frisches Paar entsteht, beträgt die Chance, binnen eines Jahres eine neue Liebe zu finden, rund zwei Prozent. Da empfiehlt sich doch eher ein Flirt in der nächsten Bar.
Die Pandemie macht dick!
Wir haben es längst geahnt, und viele Medien wiesen zuletzt eindrücklich darauf hin: In der Pandemie wurde die Menschheit immer dicker. Es drohe eine Epidemie des Übergewichts. Für Deutschland etwa wurde vor einigen Monaten behauptet, die Bevölkerung habe durchschnittlich um fast sechs Kilo zugelegt.
Diese Angabe ist ein schönes Beispiel dafür, dass man immer fragen sollte, worauf sich eine genannte Zahl überhaupt bezieht. Im konkreten Fall gab es zwar eine Gewichtszunahme um 5,6 Kilo. Diese betraf aber nur jenen Teil der Bevölkerung, der überhaupt zugenommen hatte.
Demgegenüber stand fast die halbe Bevölkerung Deutschlands, die ihr Gewicht weitgehend halten konnte. Weitere 11 Prozent hatten sogar abgenommen, und zwar im Schnitt um 6,4 Kilo. Insgesamt blieb eine sehr moderate Gewichtszunahme von 1,5 Kilo. Man kann der Pandemie sicher vieles anlasten, Fettleibigkeit gehört jedoch wohl nicht dazu.
337% heißer!
Das Jahr 2016 bot wieder einmal den wärmsten Winter aller Zeiten auf, und das trieb eine österreichische Tageszeitung mit gleichnamigem Titel zur Sensationsmeldung, wonach der Jänner um 337 Prozent zu warm gewesen sei. Tatsächlich hatte es um 2,7 Grad mehr als im langjährigen Schnitt: 3,5 Grad statt der erwartbaren 0,8, was einem relativen Anstieg von 337 Prozent entspricht. Man darf bereits Wetten darauf abschließen, dass der diesjährige Februar locker die 500-Prozent-Hürde knackt.
20% weniger Tote durch PSA-Tests!
Ein heikles Thema sind Verheißungen zum Nutzen von Screenings zur Früherkennung von Brust- oder Prostatakrebs. Um Missverständnisse zu vermeiden: Niemand rät von der Teilnahme an Screeningprogrammen ab, bloß sollte man den realen Benefit kennen. Psychologe und Risikoforscher Gerd Gigerenzer hat ihn mehrfach berechnet. Beispiel Brustkrebs: Von 1000 Frauen über 50 Jahre, die an Screenings teilnehmen, sterben binnen zehn Jahren vier an Brustkrebs. Von 1000 Frauen über 50 Jahre, die nicht an Screenings teilnehmen, sterben binnen zehn Jahren fünf an Brustkrebs. Es müssen somit 1000 Frauen ein Screeningprogramm absolvieren, damit nach zehn Jahren eine weniger an Brustkrebs verstirbt.
Bei der Prostatakrebs-Früherkennung mittels PSA-Test wurde in zahlreichen Medien immer wieder mit irreführenden Behauptungen operiert. Etwa: Das Sterberisiko sinke dank Screening um ein Fünftel. Gigerenzer zerlegte auch diese Angaben, die vor allem unangebrachte Hoffnung schüren: Die Zahl „ein Fünftel“ bezeichnet wieder einmal eine relative Reduktion.
Sie beruht auf Daten einer großen europaweiten Studie, die ergab: Ohne Screening starben nach 13 Jahren etwa 0,6 Prozent der Männer an Prostatakrebs. Unter jenen, die sich einem Screening unterzogen, starben rund 0,5 Prozent. Die absolute Risikoreduktion betrug daher 0,1 Prozentpunkte (die relative indes 20 Prozent).
Irreführend war weiters der Begriff „Sterberisiko“. Denn dank Screening starben zwar weniger Männer an Prostatakrebs, die Sterberate insgesamt wies jedoch keine Unterschiede auf. Die ständige Behauptung, PSA-Tests würden generell Leben retten, lässt sich somit nicht aufrechterhalten.
Zahl der Krebsfälle steigt dramatisch!
Bis 2025 werde die Zahl der weltweiten Krebserkrankungen in beunruhigendem Ausmaß steigen, lautete vor einigen Jahren eine Warnung, basierend auf Prognosen der WHO. Pro Jahr sei mit 20 Millionen Neuerkrankungen zu rechnen. Begünstigt unser modernes Leben Krebs in viel höherem Ausmaß als früher?
Im Gegenteil. Denn richtig interpretiert, handelt es sich nicht unbedingt um eine schlechte Nachricht: Der wichtigste Treiber für steigende Krebsraten ist die Lebenserwartung, da mit dem Lebensalter auch das Risiko einer Krebserkrankung steigt. Das bedeutet, auch wenn es zynisch klingt: Hohe Krebsraten in einer bestimmten Region sind auch ein Indikator für ein langes Leben der dortigen Bevölkerung.
Das zeigt sich etwa in Japan: Dort sind die Wahrscheinlichkeiten, lange zu leben und an Krebs zu sterben, gleichermaßen hoch.
Die meisten Verbrecher leben im Vatikan!
Ein ständiger Quell des Ärgers sind Rankings aller Art. „Die können Sie eigentlich alle in die Tonne treten“, urteilt Ökonom Bauer. Schließlich lassen sich nach Lust und Laune völlig beliebige Kriterien definieren, nach denen eine Stadt oder ein Land in einem Bereich gut oder schlecht abschneidet.
So könnte man klassische Musik als Messgröße für ein reiches Kulturleben heranziehen. Dann läge Wien gewiss weit vorn. Warum aber nicht Heavy Metal als Indikator? Dann wäre die europäische Kulturmetropole die Ortschaft Wacken in Schleswig-Holstein mit ihrem Heavy- Metal-Festival.
Schön absurde Resultate erhält man auch, wenn man verschiedene Parameter stets an der Einwohnerzahl misst. Die Hauptstadt des Verbrechens ist dann der Vatikan. Auf knapp 500 Einwohner kamen dort im Jahr 2011 fast 900 Delikte. Wird jeder Einwohner des Vatikans fast zweimal jährlich straffällig? Wohnt das Böse im Petersdom?
Natürlich nicht: Die Zahl der Delikte ist auf die rund 18 Millionen Besucher pro Jahr zurückzuführen. Das Beispiel Vatikan mag schon auf den ersten Blick einleuchten, doch das Prinzip trifft auch auf andere Städte wie Frankfurt zu, die dank eines großen Flughafens viel Durchreiseverkehr haben – und entsprechende Kriminalitätsraten.